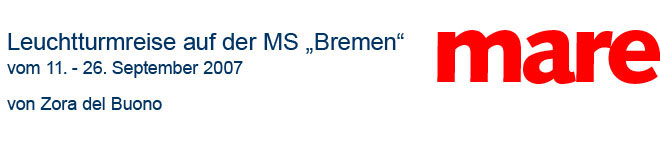

Berlin, Deutschland

Während des Packens in diversen Seitenfächern der drei Koffer gefunden:
- 1 Beutel Bautz’ner Senf, Das Original, mittelscharf. 10 ml
- Geldmünze mit Loch: Zwei dänische Kronen
- Näh-Set aus dem Hotel Waldhaus in Sils Maria
- 1 Bleistift mit Radiergummi, Werbegeschenk der Pro Senectute
- Hapag-Lloyd-Adressanhänger der Reise mit G. nach Island 2005
- 6 Tabletten Predni H 5mg: Cortison für den Hund wegen Meningitis
Eine kindliche Freude an dem Ensemble, ein wenig Scham über dieses bourgeoise Gefühl: drei Koffer aus einer Serie, dunkelblau, in unterschiedlichen Größen nebeneinander stehend wie Geschwister in Matrosenanzügen, fein gemacht für die große Fahrt, die morgen beginnt. Erinnerung an die Zeit, als das Gepäck der Großmutter selbstverständlich assortiert war, von der Handtasche bis zum Lederkoffer – was mehr über die Zeit als über die Großmutter aussagen dürfte. Die drei Koffer könnten einander erzählen von ihren jeweiligen Reisen, der Mittlere hat am meisten erlebt (sieht mitgenommen aus), der Große am wenigsten (zu träge, zu dickbauchig, Neigung zum Kippen), die Tasche war sowieso immer dabei (die notwendigen Kleinigkeiten). Heute stehen sie zusammen, gefüllt, im Flur der Kreuzberger Wohnung und warten auf die raren Momente, in denen sie als Trio brillieren dürfen: am Straßenrand, bis das Taxi kommt; auf dem Bahnsteig Berlin-Südkreuz; am Böllhornkai in Kiel, die MS Bremen als leuchtend weißer Hintergrund.
Im großen Koffer:
Cordanzug sandfarben (englische Landlady); Cordanzug petrol (ein wenig Janis Joplin); schwarzes Abendjackett lang und geschlitzt (passend zu allem); schwarzes Filzkleid (genannt Die Überwölbung; Käptn’s Dinner); 2 schwarze Hosen, eine davon elegant, die andere nicht; 3 Röcke; 5 Blusen (gelbes 70er-Jahre-Muster; grün mit bunten Knöpfen; ein Hauch von einem braunen Nichts; weiß Kurzarm, weiß Langarm – irgendeine Modedesignerin schrieb, eine Frau benötige eigentlich nur vier weiße Blusen, um allen Situationen gerecht zu werden, mal sehen, ob auch zwei genügen); T-Shirts; Wäsche; 2 warme Pullover (Norwegen! Deckspaziergänge!); Unterziehpullover; Regenjacke (Irland! Deckspaziergänge!); goldener Mantel, gefüttert, elegant; Wollpullunder, grob (der Seelenwärmer); kleine Handtasche für abends (Kabinenschlüssel, Kamera, vielleicht Zigaretten zwecks Bar-Atmosphäre).
Im mittleren Koffer:
Schwere braune Schuhe, wasserfest (dänischer Strand, Nieselregen auf englischen Wiesen); halbhohe schwarze Stiefel, klobig (Stapfen über Weiden, in der Hoffnung auf Begegnung mit meinem neuen Lieblingstier, dem Schottischen Hochlandrind; als Kontrapunkt zu den Röcken; Momente urbanen Lebens, in Portsmouth vielleicht); rehbraune Segelschuhe, gelocht (W. Somerset Maugham auf Asienreise, England sowieso, gehobener Freizeitlook); schwarze Tanzschuhe (nie die Hoffnung aufgeben…).
Dann, zwischen den Schuhen, die Reiselektüre:
- Gert Loschütz: Das erleuchtete Fenster
- Wagenbach-Anthologie: Neapel. Eine literarische Einladung
- Ian McEwan: On Chesil Beach
- Herta Müller: Herztier
- Lawrence Wright: Der Tod wird euch finden – Al-Qaida und der Weg zum 11. September
- Sportbootführerschein Binnen Motor. Mit original Fragebogen
- A. L. Kennedy: Day
Zwischen Büchern und Schuhen das, was Deutsche seit 1950 eigentümlicherweise Kulturbeutel nennen. Wir Schweizer halten es wie die Österreicher und nennen das notwendige Ding französisch: Necessaire.
In der Tasche:
Labtop; Spiegelreflexkamera, dazu ein Teleobjektiv; kleine Digitalkamera; ein grässliches Gewirr von Lade- und Übermittlungskabeln für Fotoapparate, Computer und Handy; 1 Memory Stick; sämtliche bislang eingegangenen Kurzgeschichten zum mare und TAZ-Nord Literaturwettbewerb; Reiseunterlagen; Notizbuch rot; Pass (auch rot); 2 Stifte.
Was vergessen wurde, wird unterwegs gekauft. Oder darauf verzichtet.
2. Tag - Erster Blick. Kiel
Kiel, Deutschland

Veränderungen auf der Bremen seit der letzten Reise vor zwei Jahren, also nach ihrer Überholung in der Werft (erste Eindrücke sind entscheidend, denn schnell überlagert das Neue das Alte, und das Alte wird vergessen, genau wie sich wiedererzählte Geschichten im Gehirn speichern und nicht das Erlebte geglaubt wird, sondern das Erzählte. So können Biografien und Anekdoten mit jeder Erzählung zurechtgerückt werden, der Wahrheit nach und nach entfliehen):
Geruchliches: Sie riecht, wie sie immer gerochen hat, erstaunlicherweise abgeschwächt, wie ein morgens aufgetragenes Parfum, das am Abend nur noch an diskreten, verborgenen Stellen wahrzunehmen ist. Sie riecht nicht ölig wie eine Fähre, aber doch nach Schiff, ein etwas metallischer Geruch, vermischt mit einer angenehmen Süße, die wahrscheinlich von einem Putzmittel rührt.
Optisches: Teppichboden im Club blau statt grün, die Sessel grün statt gelb, die Panoramalounge orange statt blau, der Bettüberwurf anders, die Wände auch, aber wie anders, das ist vergessen.
Akustisches: Es fehlt die Band, keine Musiker mehr aus Odessa. Dafür George Michael am Nachmittag und Edith Piaf im schon abgedunkelten Club. Beim Ablegen erst der Shanty-Chor am Ufer, dann das lange vergessene Lied, vertraut, als ob es immer da gewesen wäre: Sail away. Ein wenig verzerrt aus den Lautsprechern, die Musik evoziert Bilder von Seeleuten, die losziehen, erinnert an vergangene Fahrten, hat etwas Repetitives, Tröstliches, es wird bei jedem Auslaufen gespielt, als ob die Welt sich nie verändern könnte. Das Tuten, das laute, durchdringend und tief, die Antwort des Raddampfers Freya, hell, ein wenig schrill, dafür 100 Jahre alt. Und dann, mitten in der Kieler Förde, dies bizarre Moment: P6123, militärgraues Schnellboot der Bundesmarine, läuft ein, winkende Matrosen, plötzlich Marschmusik, laut, zu laut. Wir stehen auf Deck, zucken zusammen, die Passagierin neben mir erschüttert, sie ist entsetzt, sie denkt an Krieg, erinnert sich an vergangenes Leid.
Technisches: Die Kabinenschlüssel wurden ersetzt durch Magnetkarten, überaus praktisch, doch ein wenig traurig auch. Wie schön das Bild der schweren Metallschlüssel mit Gummiring, die bei Seegang auf den Tischen hin und her rollten (rollten sie wirklich?), dicke Zahlen eingraviert (der indiskrete Blick darauf: wer wohnt wo?). Vorhin im Club gleich als erstes die Karte verloren, Kapitän Felgner persönlich trägt sie mir hinterher.
Auch neu: Heizstrahler tauchen das Lidodeck in ein warmes Licht, ein früher zugiger Außenraum wird zu einem geschützten Ort, Sitzen auf Holzstühlen, von oben gewärmt, in eine Decke gehüllt, angenehme Kurhausatmosphäre, die Lichter der Küste noch im Blick.
Dann, nachts, draußen mit den vier Jungs der Gastband Cobblestones Betrachtung eines technischen Wunders, der Großen Beltbrücke, gestaltet als kühl erleuchtete Skulptur, schon meilenweit zu sehen. Wie ein dunkles Band legt sie sich in sanftem Schwung über uns, eine kilometerlange Flucht tut sich auf in dem Moment, als wir unter ihr durchfahren. Wir stoßen an, auf die Brücke, das Meer, den Nachtwind. Freude kommt auf.
3. Tag - Eierlikörtorte mit Sahnehäubchen
Skagen, Dänemark

Nun ist mir ja der langjährige Reisegefährte abhanden gekommen, verloren gegangen in den Schluchten von Manhattan. Das eigentümlich gelbe Skagen, bei der letzten Fahrt gemeinsam entdeckt, dieses Mal alleine durchstreift, zu Fuß, mit dem Rad. Man sieht mehr, so ganz alleine, vertraut dem eigenen Rhythmus, spricht mit Fremden, orientiert sich nach außen. Das hat durchaus eine Qualität.
Wir stehen auf dem Hügel des Leuchtfeuers (eine Art hölzerner Kran, auf der einen Seite des Arms ein Gewicht, auf der anderen ein Korb, schwenkbar, darin einst das lodernde Feuer aus Teer und Holz, Signale konnten so seit 1561 ins Dunkle gesendet werden, ganze Botschaften sogar), unter uns die Dünen, lockiges Land, ein kurzes Kennenlernen, woher kommen Sie – und Sie?, dann erzählte Lebenswege in Kürze, lapidar dahergesagte Sätze von ungeheurer Dimension: Ich bin als Grenzsoldat aus der DDR geflüchtet, bin einfach losgerannt. Als 20jähriger hat man Kraft und Mut. In jedem Passagier steckt eine Geschichte, seine Geschichte. Und: ja, die Grenze war damals schon vermint.
Dann, nach dem Dünenspaziergang, das Ehepaar im VW-Bus mit helvetischem Kennzeichen. Schweizer haben die Eigenart, sich zu freuen, wenn sie aufeinander treffen in der Welt (von wegen Schweizer: an Bord ist auch Marie aus Neuchâtel, wir sprechen erst Französisch, wechseln dann zu Englisch, zwei Schweizerinnen, die sich in einer Fremdsprache unterhalten müssen, weil ihnen ihre eigenen Landessprachen zu wenig geläufig sind; was für einer eigenartigen Nation wir doch angehören), eine kurze Plauderei mitten auf der Straße, wir sind uns einig, Skagen ist ein Ort im Zwergformat, ein wenig Legoland, ein bisschen Märklin-Modelleisenbahn. Ganz Skagen eine Spielzeugstadt, Häuser mit nur einem oder zwei Stockwerken, manchmal ein ausgebautes Dach, die Fassaden Ockergelb, Sonnenblumengelb, Zitronengelb, Senfgelb, die ganze Palette, seit Jahrhunderten an Pfingsten mit einer Mischung aus Ocker und Kalk gestrichen, umrahmt von weißen Ecken, sogar die Randziegel und Regenrinnen sind in Weiß gehalten, wie Sahnekrönchen auf Eierlikörtorte, ein wenig zu süß. Puppenland mit einem Hang zu Nippes, hinter großen Scheiben ordentlich aufgereiht, hier eine Bewohnerin mit einem Orchideen-Spleen, dort jemand mit der Liebe zu Wollspielzeug, öffentlich präsentierte kleine Neigungen, als ob Skagener Wohnzimmerfenster immer auch Seelenschaufenster wären. Höhepunkt der Inszenierung: zwei Miniatur-Jaguar in British Racing Green. Weiße Zäune und Veranden, helle Künstlerhäuser (das Licht, der Strand, die freie Liebe hat die Maler hierher geführt; was den Deutschen Worpswede, war den Dänen Skagen) mit Atelierfenstern, dazwischen vereinzelt pseudoamerikanische Scheußlichkeiten (zu viel Desperate Housewifes geguckt?), neobarocke Treppenaufgänge über millimeterscharf rasierten Grasflächen. Durchaus geschmackvoll die Müllbehälter. Dänisches Design in Holz und Metall, vor jeder Haustür wie künstlerische Objekte drapiert, als ob nicht der Impressionismus hier Einzug gehalten hätte, sondern die Konstruktiven.
Auch die Obstbäume stehen en miniature in den Gärten, an winzigen Bäumen hängen reife Birnen und Äpfel, alte Kastanien sind zu Bonsais geschnitten, eine geschrumpfte Ebereschenallee durchzieht einen Garten, die Hortensien blühen noch, ein Blumenparadies wie in südlichen Gefilden. Nicht nur ist hier alles klein, sondern vor allem leise. Alte Menschen sausen lautlos in Elektromobilen über die Gehwege, hin und her, dazwischen rauschende Fahrräder und der Wind. Am lautesten sind die Möwen, fette Tiere, die um die Fischfabriken kreisen; sogar im Hafengelände gibt es gelb gestrichene Lagerhallen. Hier riecht es nach richtigem Leben fern aller Spielzeugästhetik, nach Fisch, nach Diesel und nach Arbeit.
4. Tag - Traumwelten
Kristiansand, Norwegen

Letzte Nacht hat Karl geheiratet. Karl ist mein Arbeitskollege in Hamburg und ich wüsste nicht, dass er heiraten wollte. Es war eine mondäne Veranstaltung, als ob Jacques Brel in Nizza Grace Kelly ehelichen würde, wobei gesagt werden muss, dass die Ähnlichkeiten nicht weit hergeholt sind. Lange Dünung ist wohl das Stichwort, die Bremen schwankte im Dunkeln durch den Skagerrak. Es ist wie bei den letzten Schiffsreisen: Nächte gefüllt mit Träumen, glasklare Erinnerungen, ganze Romane werden da gespielt. Im Traum sogar die Vogue durchgeblättert, darin Schwarzweiß-Fotografien des Brautpaars, Susanne mit Hut.
Heute früh dann gleich eine Blitzumfrage unter den Passagieren gestartet:
Träumen sie auf See auch so stark? Und wenn ja, warum?
Passagier: Nein, ich träume gar nicht. Aber wahrscheinlich waren es die Trolle, die Sie nachts heimgesucht haben.
Passagier (ironisch): Hat mit dem Nordpol zu tun. Mit dem Magnetismus.
Passagierin: Das Unterbewusstsein braucht Platz für die Reiseerlebnisse, drum wird es Altes los. Was man geträumt hat, verschwindet und zack – schon ist Skagen ins Unterbewusstsein gerutscht.
Kreuzfahrtdirektor Gunter Schütze: Es liegt am Babygefühl. Geborgenheit durch Schaukeln, das verursacht süße Träume.
Passagier: Ich träume nicht, sondern habe wegen des guten Rotweins einen komatösen Schlaf.
Passenderweise findet heute das obligate Medizinertreffen statt. Auf dieser Reise sind dabei: 1 Unfallchirurg, 1 Augenarzt, 1 Autorin der Ärztezeitung; es ist eine kleine Runde. Bordarzt Dr. Bauersfeld erklärt das Phänomen (das nicht etwa eingebildet ist). Eine (wissenschaftlich nicht vollständig erhärtete) These lautet: Die enorme Massenverschiebung der Meere durch Ebbe und Flut verursacht elektromagnetische Schwingungen, unser Gehirn ist für diese Impulse besonders empfänglich, das Hormon Melotonin wird in der Epiphyse freigesetzt, der Schlafzyklus verändert, besonders die traumreiche REM-Phase wird beeinflusst. Verstärktes Träumen auf See ist daher eine Reaktion auf die Bewegung der Meere. Karls Hochzeit war also nur ein elektromagnetischer Impuls, letztlich.
Traumwelten im Realen:
Norwegen! Was für eine Landschaft! Sonnenaufgang beim Einlaufen durch die Schären, die Pier eines Steinbruchs genutzt (praktisches Schiff, die Bremen) um 7 Uhr alleine losgezogen. Spangereid ist ein kleiner Ort, weiße Würfelhäuser, ein winziges Amphitheater mit Blick aufs Meer, Sandstrand, nüchterne Schönheit, Natur und Architektur in perfekter Harmonie. Wann bin ich das letzte Mal auf einer Landstraße marschiert? Kein Mensch unterwegs, das Bedürfnis, immer weiter laufen zu wollen, ein Leben führen wie Robert Walser, der Geher unter den Schriftstellern, dessen letzte Jahre nur noch aus Spaziergängen bestanden haben (erst nur tags, dann immer mehr auch nachts). Eine Busstation, drei hochgeschossene, magere Jugendliche, Gel im blonden Haar, schweigend. Setze mich dazu, schweige auch, ein kurzes Gefühl von norwegischem Alltag, morgens auf den Autobus warten, der einen wegbringt zu einer Arbeit irgendwo in der nächsten Stadt. Im Bus schließlich noch mehr blasse, von der Pubertät Geplagte, ich lasse sie ziehen, die Landstraße liegt wieder ruhig im roten Morgenlicht.
Ein paar Stunden später dann die Einfahrt nach Kristiansand. Noch so ein herrlicher Ort, in Schachbrettform angelegt, die größte intakte städtische Holzsiedlung Europas haben sie hier, zweigeschossige Häuserzeilen säumen die Straßen, dezentes Grau wechselt mit strahlendem Weiß. Öffentliches Leben wie im Süden, auf Plätzen Marktstände, ein Caféterrasse nach der anderen, prall gefüllt mit Menschen in T-Shirts und mit Sonnenbrillen, es fehlen nur knatternde Vespas für ein mediterranes Gefühl. Neben der Kirche ein Blumenmeer, Herbstblüten vor allem in Lila und Rosa. Greise in Rollstühlen sitzen beisammen, lautes Gelächter, eine unbeschwerte Fröhlichkeit in dieser Stadt. Neben mir auf der Parkbank summt eine Frau, an uns vorbei radelt ein singendes Mädchen, später ein pfeifender Mann mit bunter Pudelmütze, tendenziell wahnsinnig, aber nett. Ein Traum, der problemlos seinen Einzug ins Unterbewusstsein finden darf.
Nachtrag zu den Skagener Sahnehäubchen: die weißen Umrandungen der Ziegeldächer haben einen Sinn. Wegen des starken Windes wurden die Randziegel mit Mörtel verputzt. Um die hässlichen Putzspuren zu verdecken, hat man die Ziegel weiß überstrichen. Und die Kamine und Regenrinnen gleich mit dazu.
Nachtrag zu der Magnetkarte: sie hat mir mein Meckern übel genommen, die Kabinentür ließ sich nicht mehr öffnen. Neu codiert, einen halben Tag ging es gut, dann wieder vor verschlossener Tür. Die Handtasche mit Magnetverschluss war schuld. Ab nun Karte getrennt von der Tasche, sprich, die Gefahr des Verlustes ist groß. Irgendwie werden wir nicht richtig warm miteinander, meine Karte und ich. Weiterhin Sehnsucht nach einem richtigen, schweren Metallschlüssel. Mit oder ohne Gummiring.
5. Tag - Unterm Apfelbaum
Nordsee

Es gibt ja unneurotische Menschen. Zu denen gehöre ich definitiv nicht. Eine meiner neurotischen Handlungen: Das genaue Lesen von medizinischen Beipackzetteln, Abschnitt Nebenwirkungen. Rasende Kopfschmerzen, rote Pusteln, Atemnöte, Leberbeschwerden, Nierenversagen, alles ist möglich und ich werde alles gleichzeitig bekommen. Das Fazit: keine Medikamente einnehmen.
Gestern Nacht standen wir auf dem leeren Lido-Deck, Stühle und Tische waren weggeräumt, festgezurrt, Sturmwarnung. Ein Tiefdruckgebiet hatte sich über Schottland gebildet und machte sich auf den Weg nach Norwegen. Also genau unsere Strecke. Die Bremen würde sich dem Wind tapfer entgegenstemmen müssen. Marie stand vor mir, rauchte eine Zigarette und hatte diese Schweizer Antiseekrankheitspillen intus, die in Deutschland vom Markt genommen sind. Ich bewunderte Marie maßlos: bei Seegang rauchen und dann auch noch dies Medikament im Körper, ganz ohne Angst vor Nebenwirkungen. Sie schlüpfte bei ihrer Tante in die Kabine und besorgte mir zwei von den Dingern, in eine Papierserviette eingehüllt. Danach legte ich mich ins Bett.
Der Doktor hatte gestern gemeint, Seekrankheit bestehe zu 80 % aus Kopf und zu 20 % aus Wetter. Die Frage ist nur, wie behandelt man seinen eigenen Kopf? Ich lag also da und nahm mir vor, mit den Wellen mitzugehen, mich in den Takt des Meeres einzureihen. Kleiner Mensch auf großem Gewässer.
Heute morgen dann ein immer heftigerer Wind, gleißendes Sonnenlicht draußen, eine trügerische Stimmung. Im Frühstücksraum nur wenige Passagiere, ein Vortrag findet noch statt, im Laufe des Tages wird aber alles abgesagt. Keine Dias gucken, kein stellen-Sie-sich-Ihr-Lieblingseis-zusammen am Nachmittag, auch kein Auftritt der Cobblestones am Abend. Heute geht’s um Seefahrt im eigentlichen Sinne. Schließlich befinden wir uns auf einer Expeditionsreise zum Thema Leuchttürme. Plötzlich gewinnt der pittoreske Turm eine ganz andere Bedeutung, gemahnt an Stürme vergangener Zeiten, an Tausende Seeleute, denen das Meer das Leben genommen hat. James Cook meinte einst, er habe die Seefahrt auf der Nordsee gelernt, keine Tücke, die es hier nicht gebe. Von Whitby aus ist er losgezogen, hat Kohlen hin und her transportiert, acht Jahre lang, bevor er sich aufmachte, mit der Endeavour die Südsee zu entdecken. Ich habe einen Nachbau der Endeavour gesehen, ganz schön beengt, so ein Schiff. Keine nette Edelyn, die Kamillentee ans Bett bringt, kein Kreuzfahrtdirektor, der tröstende Worte spricht, kein wohlriechendes Schiff, vor allem nicht die Gewissheit, dass es morgen vorbei sein wird mit dem heftigen Wellengang.
Ein paar Aufrechte mittags im Restaurant, heldenhaft Seetüchtige oder solche, die keine Angst vor Beipackzetteln haben. Mir geht’s eigentlich ganz gut, ich liege und schaukle, und liege und schaukle. Man denkt dann so dieses und jenes, ist ein wenig wie in Trance, lutscht ab und zu ein Ingwerstückchen und versucht, seinen Kopf in Richtung angenehmer Gedanken zu steuern. Und dann, ganz plötzlich, fällt es mir ein: damals, mit Mutter zu Besuch bei der Tante auf dem Land. Da stand ein Apfelbaum im Garten, daran zwischen zwei dicken Seilen befestigt ein Holzbrett, extra eingerichtet für das kleine Mädchen aus der Stadt, das sich juchzend in die Lüfte geschaukelt hat, die roten Haare zerzaust, im totalen Glück. Erinnerung auch an die besten frischen Erbsen der Welt, an Himbeeren, die es zu pflücken gab und Haselnüsse, die zu knacken waren. Und immer wieder diese Schaukel. So liege ich heute also in der Kabine, gebe mich den Wellen hin (juchze nur in Gedanken) und bin ganz froh. Und hoffe, dass die über und unter und neben mir sich auch an irgendeinem netten, schwingenden Ereignis aus der Kindheit freuen können. Wenn’s schlimmer wird, liegen ja immer noch Maries Tabletten neben mir, ganz ohne Beipackzettel.
6. Tag - Jeff
Peterhead, Schottland

Es gibt Tage, an denen geht es auf diesem Schiff morgens zu wie in einem Bienenkorb. Alle schwärmen aus, verteilen sich in verschiedene Richtungen und finden dann abends wieder zusammen. Heute ist so ein Tag, gleich drei Ausflüge werden angeboten. Das Gemeinschaftsgefühl der Passagiere ist gewachsen, die letzten 36 wilden Stunden haben eine Verbindungsschnur geschaffen, zusammen wird der Wetterbericht für die nächsten Tage studiert und seufzend kommentiert.
Von insgesamt 135 Passagieren sind:
41 zum Kinniard Lighthouse gefahren
44 in die Fyvie und Pitmedden Gärten auf Kräuterschau gegangen
17 Unverdrossene durch das Forvie Naturschutzgebiet gewandert
Ich habe dafür Jeff kennen gelernt. Manchmal liegen schöne Erlebnisse ganz nah. Jeff hat rotblondes Haar, eine Stupsnase und ein offenes Grinsen, das sich wie bei einem Kobold über das ganze Gesicht zieht. Jeff ist Busfahrer und er hasst seinen Job. Nicht diesen Morgen, sondern erst heute Nacht wieder. Dann wird er eine Ladung sturzbetrunkener Hochzeitsgäste über Land fahren müssen. Heute früh ist er für uns da, er ist der Fahrer des Pendelbusses in die Stadt. Weil der Bus so groß ist und ich der einzige Gast, ergibt sich eine private Atmosphäre, die zum Plaudern einlädt. So fahre ich mit Jeff hin und her, und gleich noch einmal hin und her, durch das Hafenviertel, über die Einfallstraße bis nach Peterhead, schwerfällige Manöver durch enge Straßen. Zwischendurch warten wir an der Bushaltestelle im Zentrum und schauen den Passanten zu, die durch den grauen Ort gehen; eine Stadt, ganz aus bräunlichgrauem Granit erbaut.
Jeff streichelt die hölzerne Ablage seines alten Busses und sagt: she is a good girl. Den Bus mag er gerne, wenn nur die Passagiere nicht wären, vor allem nicht die gefährlichen, die mit den Messern. Schottland leidet unter einem sozialen Problem: knife crime. Messerstechereien. Diese Kultur der Gewalt gibt es schon lange, aber noch nie war sie so groß. Jeff also liebkost seinen Bus und erzählt mir sein Leben. Er ist 42 Jahre alt und bereits Großvater. Das wäre hierzulande nichts Unübliches, aber in diesem Fall sind die beiden Kinder (the twins) nicht seine leiblichen, doch was macht das für einen Unterschied? Er liebt sie so oder so. Die Konstellation allerdings ist bemerkenswert, seine Frau ist schwer behindert und Mitte 50, die beiden Jungs schon 30 Jahre alt. Nicht zu vergessen der Exmann, der brutale Säufer, wegen dem sie geflüchtet sind aus dem Süden, denn da kommen sie eigentlich her, und jetzt wird auch verständlich, warum die Konversation mit ihm so flüssig geht, da spricht kein Schotte seinen dunklen Dialekt, sondern ein Engländer klares British. Jeff strahlt, wenn er von seiner Frau erzählt, deren Leidenschaft es ist, Einkaufslisten zu schreiben. Schreiben fällt ihr wegen ihrer Behinderung schwer. Wenn sie etwas Wichtiges schreiben muss, macht sie erst eine Rohschrift, voll mit Orthografiefehlern, dann eine Abschrift, die ist säuberlich und fehlerfrei. Wenn sie jemanden aber liebt, dann schenkt sie ihm die Rohschrift; Jeff lächelt und wir wissen beide, dass er es ist, der immer die Rohschrift mit den vielen Fehlern bekommt. Wir zeigen uns gegenseitig Bilder von unseren Hunden (Cocker Spaniel, Windspiel), kein Mensch steigt zu. Jeff schaut auf die Uhr und wir fahren zurück zum Schiff. Ein riesiger Reisebus in regnerischer Landschaft, darin ein Südengländer, der wegen der Liebe nach Schottland gekommen ist und eine Passagierin, die sich freut, wenn ihr jemand Geschichten aus dem wahren Leben erzählt. Die blonde Schottin am Zaun winkt ab, als ich meine Magnetkarte nicht auf Anhieb finde, und meint: naproblaam malaaf. Was wohl heißen sollte: no problem, my love.
7. Tag - Von Blondinen, Pfarrern und küssenden Pudeln
Gairloch, Schottland

Heute bin ich zwei Göttern begegnet, habe mich von drei Blondinen chauffieren lassen, habe ein halbes Dutzend geblümelte Hotelzimmer betrachtet, einen Gratiskaffee serviert bekommen, einen stöhnenden Pfarrer kennen gelernt, Psalm 15 auf Englisch gesungen, am Grab von Jessie Mackenzie gestanden, und zu guter Letzt einen Zwergpudel in der Heidelandschaft geküsst.
Es ist, kaum verwunderlich, ein Sonntag. Sonntag in Gairloch, Schottland. Mein Landgang dauerte nur vier Stunden, aber was man in vier Stunden alles erleben kann, ist schon enorm. Doch der Reihe nach:
Die erste Blondine ist Isabell, Bordfriseurin und Steuerfrau des Zodiacs (eine Art rasendes, schwarzes Gummiboot), das mich mit Schwung durch die Wellen an Land bringt. Wir ankern heute in einer Bucht, die auch in der Südsee liegen könnte, ein wenig Neuseeland, unberührt, Wälder wechseln mit niedrigem Gewächs. Felsformationen schauen aus dem Wasser wie ruhende Wale, mit Grün überzogen, aus der Ferne sieht man schon das üppige dunkelrote Heidekraut, das sich die Berge hochzieht.
Der Hafen liegt außerhalb Gairlochs, drum stelle ich mich an den Straßenrand, ganz wie früher, und trampe. Gleich der erste Wagen hält, darin eine weitere Blondine mit riesiger CD-Sammlung auf dem Beifahrersitz, die Musik ist an. Setze mich auf die Rückbank und werde in die Stadt gefahren, die eher ein Dorf ist; Sommerfrische der Schotten, mit einem angeblich mondänen Hotel aus viktorianischer Zeit. Das Hotel lebt von seinem verblichenen Glanz, ist nicht ohne Charme; der Manager führt durchs Haus, von Zimmer zu Zimmer, durch den Tanzsaal mit Spiegeln, einen Speisesaal, der zu Zeiten des 2. Weltkrieges als Lazarett diente. Trinke mit ein paar älteren Damen und Herren einen dünnen, ein wenig gräulichen Kaffee. Sie warten auf den Bus zum Flughafen Inverness, ich warte auf gar nichts, sitze nur ganz zufrieden in dieser Runde, und da fällt mir auf: hier ist alles rosa. Gesprenkelt, geblumt, kariert, aber rosa. Das Mobiliar, die Vorhänge, der Teppichfußboden, das Hemd der Dame gegenüber, ihr Lippenstift, ihr Turnschuh, eine Ansammlung verschiedenster Rosatöne, mauve, lila, aubergine, himbeerrot, pink. Einzig das Herrenzimmer ist in braunem Leder gehalten; man ahnt, wie sie darin gesessen und geraucht haben, politische Gespräche führend, eine Art Club mit Blick auf das raue Meer. Heute darf hier nicht geraucht werden und von Herrenzimmer kann auch nicht mehr die Rede sein (zumal in Schottland auf den Herrenklos Wickeltische stehen, wurde mir von einem Passagier gesagt – wie fortschrittlich), der Raum sieht ein wenig verloren aus, als sehnte er sich nach den Zeiten der dicken Zigarren zurück.
Dann, das erste Erlebnis mit Gott (Kirchenbesuche im Ausland haben einen gewissen Reiz, sogar für mich als Nicht-Kirchgängerin. Ich erinnere mich an aufregende Stunden in einer Baptist Church auf den Bahamas, Gospel singende, weinende Menschen in bunten Gewändern kurz vor der Ekstase; an den Besuch einer orthodoxen Messe in Kaliningrad, weihrauchgeschwängerte Luft, üppiges Gold, feierliche Stimmung; an eine überaus trockene Veranstaltung in South Carolina, ein rein weißes Publikum in einer ansonsten mehrheitlich von Schwarzen bewohnten Stadt): Die Kirche steht auf einem Fels über dem Meer, Männer in dunklen Anzügen bitten mich herein, ein hübscher Raum mit blauen Wandlaibungen, eine Leiter führt direkt ins Dach, Wasserschaden, der Putz bröckelt, für einen neuen Teppich wird gerade gespart, auf der Empore liegt er schon. Einer der netten Herren zieht das Seil, die Glocke erklingt. Es ist die Free Church, eine radikal protestantische Gruppierung, 1843 abgespalten von der restlichen Kirche, fundamentalistisch wie die alten Calvinisten in Holland. Die schmächtigen Herren sind reizend, der Referend wird mir vorgestellt, er riecht nach Fish&Chips-Bude, das Jackett speckig, gesprenkelt wegen der Schuppen, ein Furcht einflößender Mensch. So geht es dann auch auf der Kanzel weiter, wir sitzen schweigend da, sein Mikrofon ist schon an, er merkt nicht, wie sich sein Atem rhythmisch stöhnend über uns wölbt. Der Gottesdienst beginnt, wir singen, er spricht, spricht von unseren Sünden, davon, was Gott von uns will und was nicht, es ist alles eher bedrohlich als tröstend. Draußen hinter den Mosaikfenstern das Meer, ich stelle mir vor, wie die Seeleute hier gebetet haben, für ruhige See und guten Fang; die Frauen für gesunde Kinder und die Rückkehr ihrer Männer. Drinnen zwanzig Menschen, die alten Frauen allesamt mit runden Kappen aus dunklem Samt, aus jedem Hut ragt ein kleiner Zipfel heraus, Uniformität in der Sonntagstracht. Es ist ein trauriger Anblick, diese kleine Gemeinde, die nicht mit der Zeit mitgegangen ist und moralisierend auf alten Vorstellungen beharrt und all ihre Kinder verliert durch ihre Nüchternheit. Selten habe ich mich so katholisch gefühlt.
Noch weiter außerhalb des Ortes direkt neben dem Golfplatz eine zweite Kirche, gut besucht, schnatternde Menschen, Gemeindemitglieder der Scottish Church, auch sie protestantisch wie alle hier, aber offen. Glück hatte, wer in solch eine Familie geboren wurde. Ein Ehepaar winkt ab, als ich sie auf die Free Church anspreche, ihr Gott ist ein freierer Gott, keiner, der ihnen droht, sie danken es. Der alte Friedhof liegt still da, keine Wege führen mehr zwischen den Gräbern durch, Moos überzieht die Grabsteine, es ist ein friedlicher Ort. Vor mir liegt Jessie Mackenzie, gestorben an meinem 29. Geburtstag, im Alter von 101 Jahren. Ich stelle mir Jessie Mackenzie vor, wie sie als junges Mädchen (vielleicht war Jessie ein Mann, aber ich imaginiere sie mir lieber als Frau) gestaunt hat, als im Dorf das elektrische Licht eingeführt wurde, wie sie Fische geputzt hat, vielleicht einen Seemann geheiratet oder den lokalen Wirt, wie sie älter wurde und Krieg um Krieg miterlebt hat, eine Schar von Kindern, von denen einige nie das Erwachsenenalter erleben durften. Vielleicht ist sie aber auch eine Miss geblieben und hat als kleine Angestellte im lokalen Armenhaus gearbeitet oder sie war gar die Madam im Hotel Gairloch.
Von der Kirche führt ein Weg durch hügelige Heidelandschaft, Erika (schon wieder lila) und Heidekraut (eine andere Schattierung) stehen dicht beieinander, umwerfende Landschaft, ein Pfad führt über Klippen und durch Farnwälder, Gewächse aus urtümlicher Zeit. Ein Pudel rennt auf mich zu, ich bücke mich zu ihm herunter, er küsst mich und ist auch schon wieder weg. Der Wind bläst, der Himmel reißt kurz auf, das Hochland präsentiert sich in prachtvollen Farben. Am Steg wartet die dritte Blondine, Krankenschwester Tanja, und bringt mich im Zodiac in rasanter Geschwindigkeit zum Schiff zurück.
8. Tag - Davids Schwalben
Isle of Man, Schottland

Eigentlich wollte ich heute über Schuhe schreiben. Schuhe haben eine nicht zu unterschätzende Bedeutung auf Kreuzfahrtschiffen, aber nachdem mir bitter klar geworden ist, dass meine Tanzschuhe nicht zum Einsatz kommen werden, habe ich mich (ein wenig trotzig) auf die Schuhgeschichten fremder Leute kapriziert. Und die hätte ich jetzt gerne erzählt – wenn nicht David, Anne, Paula und ihr Baby dazwischen gekommen wären.
Isle of Man, mittägliches Sonnenlicht, grün schillernde Hügel, ein eleganter Schwung blendend weißer Fassaden an der Strandpromenade, Douglas könnte eine südenglische Bäderstadt sein. David und ich stehen auf dem Hügel und betrachten das Szenario von oben, über uns thront nur noch ein viktorianisches Hotel aus dunklem Backstein, ein wenig Hitchcock, ein wenig Rosamunde Pilcher, dahinter Küstenlandschaft und dieses fast schon irreale Grün der Wiesen, dekorativ gefüllt mit zerzausten Bäumen. Hatte mich vorhin schon gefragt, ob die Farben eine Sinnestäuschung sein könnten – jetzt, wo ich vom Doktor die Auskunft erhalten habe, dass der schwankende Boden an Land meiner Endolymphe geschuldet sei, den Härchen im Innenohr, die wild durcheinander stehen und nicht zur Ruhe kommen wollen. Vielleicht hat die Wahrnehmung dieses gleißenden Grüns ja auch mit der Endolymphe zu tun und ich gucke schon ganz schief, vielleicht liegt es aber einfach nur an der Natur, die hier brilliert, als sei sie nur dafür gemacht, uns zu erfreuen. David raucht, ich rauche mit, plötzlich das lang anhaltende Tuten eines Schiffshorns, oh, die Bremen, legt sie heute früher ab? Ein Moment der Irritation, so wie gestern Andreas, der schmale Musiker mit den verspielten Locken, der weit über Gairloch am Wasserfall stand, als er das Horn der Bremen hörte, ein Zeichen wie im Schulhof, kommt her, wir fahren früher los. Seine kurze Panik, er könnte es nicht mehr schaffen und hoch im Norden Schottlands vergessen werden. Es ist nur die Schnellfähre, die sich auf den Weg nach Liverpool macht, schnittig, aber hässlich.
Vorhin in der Innenstadt, zwei Szenen, wie sie unterschiedlicher nicht hätten sein können: Ein Internet-Café mit einem Dutzend Computer, ockerfarbende Wände, in einer Reihe sitzen Menschen, die gleichzeitig tippen und essen, Fastfood unbesehen in sich hineinschaufeln, es riecht bedenklich nach altem Fett, die Luft scheint gelblich zu schwirren, rechts neben mir eine Rothaarige über einem Teller Chinapfanne, links ein kahlköpfiger Mann in rosa Hemd (natürlich rosa) und mit Krawatte, schnaufend und schwitzend, ich spähe auf seinen Bildschirm, erstaunlich ungeniert konsumiert er erstaunlich grobe Pornographie, hektisch an einem Hühnerknochen kauend. Ich beeile mich mit meinen Mails; die Wärme, der Geruch, der Mann neben mir, der schwankende Bildschirm, mir ist nach frischer Luft zumute. Dann, kaum auf der Straße, zwei Damen mit Kinderwagen, sie sprechen mich an, Zeuginnen Jehowas, wie sich bald herausstellt. Seltsam, gestern noch die Moralwächter von Gairloch, als erstes dann heute der lüsterne Angestellte, in der Mittagspause Sex auf dem Bildschirm konsumierend, danach Paula und Anne samt Baby, die auf wirklich alle Fragen, die das Leben so stellt, die passende Bibelstelle parat haben. Ich begleite sie ein wenig durch die Straßen dieser wirklich hübschen Stadt, Viktorianisches wechselt mit Jugendstil, zarte Balkone ringeln sich Fassaden entlang, burleske Schmiedearbeiten neben moderner Architektur. Paula und Anne wollen mich zu ihrem Zentrum führen, Regentropfen fallen aus fast wolkenlosem Himmel, sie reden über Gott und die Welt, oder eigentlich nur über Gott, denn von der realen Welt wollen sie wenig wissen. Das Baby döst zufrieden, und auf meine Anmerkung, dass ich sie ein wenig um die Antworten beneide, die sie auf jede Frage haben, nicken die beiden beseelt. Wir verabschieden uns freundlich, wissend, dass wir nicht zueinander finden werden.
Und dann taucht David auf, ein Geschenk des Himmels gewissermaßen, ein ganz normaler Mensch, kein religiöser Eiferer, einfach ein Taxifahrer, der sich zu meinem Glück als alter Seemann entpuppt und schließlich neben mir auf dem Hügel seiner Stadt steht, während die Fähre sich auf ihren Weg aus dem Hafen macht. David erzählt vergnügt, wie er einmal seinen Frachter verpasst hat, damals, als junger Matrose. Im Norden von Brasilien war es und er konnte selber zusehen, wie er weiter in den Süden zum nächsten Hafen kam, ohne Geld, ohne Papiere, mit einem wütenden Kapitän, der auf ihn wartete. Aber irgendwie hat er es geschafft. Er zeigt mir seine bunten Bilder auf der Haut, Zeugen eines echten Seemannslebens.
Aus der Ferne sehen wir auch die Überreste eines abgebrannten Ferienresorts, und ich überlege mir, wie es wohl sein muss für die paar Jugendlichen, die in Douglas wohnen und wissen, dass ihre Zündeleien 50 Menschen das Leben gekostet haben, es ist noch gar nicht lange her. Die Polizei kennt die Namen der Kinder, raunt man in der Stadt, aber sie hält sie geheim, zum Schutz der Kids, die zu Brandstiftern wurden.
Nachdem ich mit David einen kleinen Teil der Rennstrecke des berühmten Motorradrennens abgefahren bin, er mir sein Wohnhaus gezeigt hat, ein kleines, wirklich sehr kleiner Bungalow, nachdem er mich die Hügel hoch und runter chauffiert hat, bringt der alte Seemann mich zum Hafen zurück. Ich gehe über die weichen Teppiche des leeren Fährterminals, leise Musik plätschert über mich, weiter durch eine schier endlose, schmale Wartehalle aus viktorianischer Zeit, ganz in Blau getaucht, hauchdünne gusseiserne Säulen stützen dieses filigrane Gebilde und ich sehe Davids Hände noch einmal vor mir, denke an den großen Siegelring mit Logo des Liverpooler Fußballclubs darauf, Everton. Zwischen Daumen und Zeigefinger zierte eine tätowierte Schwalbe die gelebte Haut, auf der rechten Hand stand DAVID darunter, auf der linken VAU, der Name seiner Frau. Und mir kommt ein Ehepaar an Bord der Bremen in den Sinn. Beide haben Tattoos an Stellen, wo weniger verwegene Leute ihre Schnürsenkel binden, aus der Südsee mitgebrachte, mythische Erinnerungen. Womit wir wieder bei den Schuhen wären.
9. Tag - Nichtstuer und andere Freaks
Waterford, Irland

Vielleicht liegt es einfach am 1. Offizier. Oder daran, dass der Mensch mal eine Pause braucht, das Gehirn zu klein ist oder zu voll. Heute wollte ich auf alle Fälle nichts tun, möglichst wenig erleben, keine Fremden auf der Straße ansprechen, höchstens auf ein paar Seiten mit Osama Bin Laden in seiner Löwenhöhle im afghanischen Bergland verschwinden (sehr empfehlenswertes Buch, siehe 3 Koffer in Berlin), ein eher vegetatives Dasein führen also. Nur ein wenig sitzen und in die Landschaft schauen, auf dem Sonnendeck liegend über den Frachthafen von Waterford blicken und mich vom irischen Grün einlullen lassen, vielleicht ein, zwei akkurat gestutzte Hecken studieren (das können sie bemerkenswert gut hier), maximal 1,8 Kilometer Fahrrad fahren, mehr bitte nicht.
Der 1. Offizier hatte frühmorgens, über seinem Schreibtisch lehnend, gemeint, er gehe eigentlich nie von Bord – was ich ihm erst nicht glauben wollte. Jeden Tag in einem anderen Hafen, all diese herrlichen Orte mit den verlockenden Namen, Reykjavik, Aden, Pitcairn, Montevideo, und nie ein Landgang? Er macht aber nicht den Eindruck eines schlimmen Zynikers, und so nahm ich ihn beim Wort; vollends plausibel erschien es mir, als er erklärte, er sei schließlich nicht zur Seefahrt gekommen, um dann an Land rumzuhampeln. Genau so wollte ich es heute auch halten – und ich war nicht die einzige.
Es ist nämlich so, dass die Passagiere an Bord der Bremen in mehrerlei Hinsicht in zwei Hälften auseinander fallen, die Übergänge sind fließend, aber eine Grundtendenz ist nicht zu übersehen:
1. Es gibt die Ausflugsteilnehmer und die Ich-spazier’-mal-hier-in-der-Gegend-herum-Gäste. Interpretationsmöglichkeiten über die unterschiedlichen Charakterzüge der jeweiligen Gruppe gäbe es vielfältige.
2. Dann wären zu notieren die diametral entgegengesetzten Gepflogenheiten, was das Mittagessen anbelangt. Restaurant versus Club, sprich, sich am eingedeckten Tisch nett bedienen lassen oder vom Buffet diverse Kleinigkeiten holen und diese an niedrigen Cocktailtischen verspeisen. Als ich neulich mittags ins Restaurant geschaut habe, saßen da lauter fremde Menschen, im Club hingegen fast nur vertraute Gesichter.
3. Bei dieser Reise der wohl wichtigste Unterscheidungspunkt: Leuchtturmfreaks, leidenschaftlich, wissbegierig und voller Enthusiasmus für alle Geschichten rund um die Lighthouses. Und all die Anderen…
Da ich zu den Anderen gehöre, eine Blitzumfrage unter den echten Leuchtfeuer-Liebhabern: Was ist es, das Sie am meisten an Leuchttürmen fasziniert?
- Passagier: Es ist die Einsamkeit, die sie verkörpern.
- Passagier: Die großen Opfer, die erbracht wurden, um sie zu erbauen.
- Passagier: All die unglaublichen Mythen, die existieren.
- Passagier: Ich liebe Schmuggler-Geschichten.
- Passagierin: Angefangen hat es 1983 mit dem Lied ‚Leuchtturm’ von Nena.
- Passagier: Sie symbolisieren das Meer. Ehrlich gesagt, ich könnte mich auch für Wale begeistern. Oder für Algen.
- Passagier: Ich bin zur See gefahren. Alle Seeleute mögen Leuchttürme. Sie symbolisieren die Rückkehr.
- Passagierin: Die Technik ist es. Die Optik.
- Passagierin: Die Stimmung nachts in einem Leuchtturm, das Funkeln, das ist wunderschön zu fotografieren.
- Passagierin: Heimweh nach der Ferne.
- Passagierin: Le son des sirènes.
- Passagierin: Sie stehen immer in extremen Landschaften.
- Passagierin: Ich liebe alles Alte; Burgen, Kirchen, Leuchttürme. Das Erhabene.
- Passagier: Am Ende des Weges steht immer der Leuchtturm.
- Passagier: Weil sie die Seefahrer am Leben erhalten. Ich wäre schon an mancher Klippe zerschellt ohne Leuchtturm.
- Passagierin: Ich sammle Leuchtfeuer. Bis heute habe ich 1027 gesehen.
Einer der Musiker fragt, ob keiner der Fans die phallische Komponente der Türme erwähnt habe. Nein, kann ich nur sagen. Hat keiner (womit bewiesen wäre, dear Captain, dass nicht nur Frauen auf diesen Gedanken kommen können).
10. Tag - Der Selbstversuch
Cork, Irland

Der Wagen hat einen strengen Eigengeruch, eine zerknitterte Chipstüte klebt im Handschuhfach, Zigarettenspuren auf den Sitzen, ein bedrohlich leerer Tank, der Kilometerstand liegt bei 84.507. Vielleicht sind es auch Meilen, das ist in Irland nicht so ganz klar, jetzt, wo sie hier alles von Meilen auf Kilometer umstellen – was während des Fahrens zu allerlei Irritationen führen kann; es dauert ein Weilchen, bis ich merke, dass nicht allen Straßenschildern die selbe Maßeinheit zu Grunde liegt. So wie der Mietwagen riecht, sah auch das Büro des lokalen Verleihers aus, mintgrüne Wände, vor langer Zeit das letzte Mal gestrichen, Kippen in Aschenbechern, vergilbte Plakate schief geklebt, handgeschriebene Zettel, welche der fünf Autos gerade verliehen sind, nicht unsympathisch, das alles.
Schon beim morgendlichen Einlaufen in Cork diese eigentümliche Farbwahl der Häuser bemerkt, so gelb wie Skagen war, so grau die schottischen Städte, so hell die Isle of Man, so bunt ist es hier, um nicht zu sagen: kunterbunt. Uniforme Reihenhäuschen erhalten durch satte Farben eine Individualität, werden zu kleinen Charakteren. Geschmackvoll ist das nicht, auch nicht kühl und klar wie die farbigen Häuser der norwegischen Schären, es sieht mehr nach kindlicher Freude aus, nach Zufall und ausgelebtem Eigensinn.
Auf Landstraßen planlos gen Westen fahren, eine grob gezeichnete Faltkarte auf dem Beifahrersitz, das Radio ist an, Amy Winehouse singt, alles ist gut. Autofahren leert den Kopf, die Dinge ordnen sich, Bilder von Passagieren kommen und gehen, Geschichten, die erzählt wurden, ich mache mir so meine Gedanken über diesen oder jene. Dann plötzlich die Szene von gestern, die Frau, die von der bezaubernden Stimmung in einem nächtlichen Leuchtturm erzählt, ihre Schilderung ausdrucksstark, wir stehen vor der Treppe auf Deck 4. Und schon ist es wieder da, mein schlechtes Gewissen der letzten Tage: immer noch keinen Leuchtturm von innen gesehen. So begeistert, wie sie alle davon schwärmen, es muss etwas dran sein an dieser Obsession, ich habe es nur noch nicht verstanden, denke ich mir. Und entschließe mich, es zu ergründen, und zwar jetzt.
Der Old Head in Kinsale ist mein Ziel. Südirische Landschaft, üppige Vegetation, gefleckte Kühe auf den Wiesen, immer wieder bunte Dörfer, eine gute Stunde Fahrtzeit bis zur Küste. Ich stelle mir vor, wie ich vor dem Leuchtturm stehen werde, wie mir der Wind sacht ins Gesicht weht, ich eine schmale Wendeltreppe nach oben steige, sich verjüngend oder auch nicht, farbig getüncht oder auch nicht, wie sich der Handlauf anfühlt, ein wenig rau von den vielen Menschenhänden und der langen Zeit, wie ich auf der Plattform über das Land und das Meer schaue und dann endlich, weit oben, die gläserne Pracht bewundern werde, ganz allein wir beide, das Licht und ich.
Immer dichterer Regen, eine Caravansiedlung, die in Amerika stehen könnte, aufgebocktes Sommerglück in Reih und Glied, kaum ein Mensch hier heute, Wäscheständer klimpern im Wind, die Stromleitungen surren wie früher.
Ein Schild, Old Head, dichte Hortensiensträucher in langsam endender Blüte, ein eisernes Tor, dahinter eine Holzhütte, zugig, knarzig, darin ein dicker Mann. Er ist der Wächter jenes edlen Golfclubs, der heute die gesamte Landzunge überzieht. Ein Anruf zum Club, eine Margaret am Apparat, nein, die Leute von der Bremen sind leider schon weg, und nein, eine Einzelbesichtigung ist nicht möglich, nein, Ausnahmen gibt es auch nicht, sorry Madam. Aber einmal drum herum fahren, das darf ich doch, es wenigstens aus der Ferne betrachten, das Objekt meiner Begierde?
Ich darf. Die Landschaft ist sogar im Sturm spektakulär, die schmale Straße führt durch Hagebuttenhaine, ich parke beim Clubhaus, ein moderner, niedriger Bau, ganz in die Umgebung eingepasst, eine elegante Natursteinfassade, Männer in weißen Schuhen trotzen dem Regen, achten nicht auf die Signale des Turms, die durch die nasse Landschaft tönen. Ich betrete den Raum, da steht gleich ein Schild: Members and guests only. Daneben: Dress code. In der Mitte des Raums ein loderndes Kaminfeuer, von Sofas umringt, hinter der Scheibe der schwarz-weiße Turm, dahinter nur noch der Atlantik.
An der Bar arbeiten gepflegte Männer in blau karierten Hemden, ich bestelle Tee und eine Kleinigkeit zu Essen. Langsam entspanne ich mich, keiner fragt nach meiner Membership. Der Barmann kommt: Is this a good day for you? Was für eine ungewöhnlich höfliche Frage, denke ich und antworte, yes, it definitly is.
Gemütlicher und gediegener ist das Leben kaum möglich. Jameson Whiskey trinkende Männer sitzen an einem Kaminfeuer, Frauen mit perfekter Frisur (Haarspray!) und pastellfarbenen Shirts (mit Kragen! Dresscode) nippen an bunten Drinks, die blau karierten Kellner schweben zuvorkommend zwischen den Tischen durch, draußen dieser Regen, der Strahl des Leuchtturms, kein Signalton ist hier drin zu hören. Mein Selbstversuch Wie-werde-ich-ein-Leuchtturmfan ist kläglich gescheitert, ich sitze dekadent in einem der vornehmsten Golfclubs der Welt (Mitglieder aus 42 Staaten! Very famous!), trinke Tee und plaudere.
In Cork dann noch per Zufall das soziale Gegenprogramm erlebt, habe eine Bowling-Bahn aufgesucht, schon immer wollte ich so etwas sehen. Ich betrete das schlichte Gebäude und kann es nicht fassen: eine riesige Fläche auf zwei Etagen, unten die Bowlingfläche wie Perlmutt glatt leuchtend, kaum ein Mensch ist da, drum herum aber Maschinen und Spielautomaten, so laut und schrill, dass selbst Las Vegas ein Ort der Besinnung ist. Autorennen, Computer, eine Musikbox neben der anderen, nach vier Metern schon das nächste Lied, hier Michael Jackson, dort Madonna, die Lautstärke und die Farben schrill und wild, Stofftiermaschinen seufzen, weit hinten blinkt und hupt ein Ding, zu dem ich schon gar nicht mehr hingehen mag: es ist ein Spielgerät in Leuchtturmform.
11. Tag - Krokodile an Bord
Scilly Inseln, Irland

Der Bootsmann spritzt das Backdeck und ich weiß: heute ist es soweit. Heute werde ich über Schuhe schreiben.
Ich stehe auf der Brücke, das Radio spielt leise Musik, der Navigationsoffizier studiert seine Karten, zeichnet mit Bleistift die Kurse ein, er ist gedanklich bereits in Spanien angelangt. Ansonsten ist die Brücke leer, erst später kommt der Chief Engineer dazu. Wir liegen vor Anker (am Haken), die Scilly-Inseln umarmen uns, keine Pier weit und breit.
Jetzt sind sie alle weg. Losgezogen in zwei hölzernen Barkassen, eine Schar bunter Regenjacken auf hellblauem Grund, langsam kleiner werdend Richtung Horizont. Es herrscht, ich gestehe es, eine herrliche Ruhe an Bord, eine fast schon intime Atmosphäre, sanftes Schwanken verstärkt das verinnerlichte Gefühl. Ein Tag, der zum Plaudern verführt, und so rede ich mit dem Chief, anfänglich über Technisches und schließlich über – Shampoo.
Zuerst zum Technischen: Der Tag vor Anker wird genutzt. Und zwar zur Überholung der Düsen des Hauptmotors, zur Reinigung der Filter und Kondensatoren des Klimakompressors, Vorbereitung für die Fahrt in warme Regionen. Und schließlich wird die Vorauskamera installiert, Datenkabel werden zur Brücke gezogen, bald kann jeder online auf der Bremen mitfahren, noch klafft ein Loch in der Decke, Staub rieselt auf das Fernglas. Und wie es mit den Plaudereien so geht, gibt ein Thema das nächste und irgendwann landen wir bei den Haaren des Chiefs. Die sind grau meliert und von außergewöhnlicher Eleganz und Stärke. Es liegt wie in den meisten Fällen in der Familie, nur ist es diesmal nicht nur genetisches Glück, sondern auch weibliche Kompetenz. Die Frau des Chiefs ist Friseurmeisterin in der Oberlausitz. Das ist aber nicht alles: die eine Tochter ist Dritte Deutsche Meisterin für Kosmetik und die andere Tochter trägt den wunderbaren Titel Europacupsiegerin für Langhaar- und Hochzeitsfrisuren. Das Shampoo, das er benutzt, stammt aus dem Schatz seiner drei Meisterinnen. Ich werde mir den Namen des Produkts notieren müssen. Später sprechen wir über Führungsstil und den Zusammenhalt der Männer in der Maschine, über den Aufenthaltsraum auf Deck 3 und darüber, dass gerne auch mal andere Crewmitglieder zu Besuch kommen.
Wie wir so am Brückenfenster stehen und ich über den Satz Ich achte darauf, dass Sonntage auch Sonntage bleiben nachdenke (der Chief ist Katholik und die Philippinos in der Maschine sind es auch), sehe ich also diesen Bootsmann im weißen Overall, wie er das Deck schrubbt. Ich schaue auf seine Füße, sie sind in der Tat sehr groß, man hatte mir schon davon erzählt (oder wie der 1. Offizier sagte: das ist verdammt noch mal der größte Philippino, den ich je gesehen habe). Und so kommen wir jetzt zu der ersten Schuhgeschichte, die auf den Philippinen beginnt und Tausende Seemeilen entfernt in Argentinien endet. Der lange Bootsmann, genannt Bosun, stammt aus Bohol und besaß ein Paar Arbeitsschuhe. Daher war das mit den großen Füßen alles erst kein Problem, für die Zeit in der Antarktis aber brauchte er dringend warme Stiefel. Und so machte sich Kapitän Felgner auf den Weg durch die Schuhläden der südamerikanischen Hafenstädte. Rio, Montevideo, Buenos Aires. Keine gefütterten Stiefel in Größe 48, nirgendwo. Der Kapitän wurde langsam unruhig, der Mann tat ihm leid, es war nicht mehr weit ins Eis. Erst kurz vor der Drake-Passage wurde er fündig: Sandfarbene Caribou-Stiefel in Ushuaia, ein Geschenk für den Bosun, er trägt sie heute noch.
Große Füße können ein Problem sein, kleine aber auch. Manchmal wird die Bremen von Japanern gechartert, alle wollen sie ins südliche Eis. Und weil die Japaner so kleine Füße haben, lagern jetzt auf Deck 7 winzige rote Gummistiefel und warten auf ihre temporären Nutzer. Die Stiefel werden übrigens nach jeder Reise gereinigt und desinfiziert. Keine asiatischen Fußpilze also zwischen deutschen Zehen und keine europäischen auf zarten Japanerfüßen.
Weitere Schuhgeschichten?
Viel viele Schuhe hat ein Offizier mit an Bord? In der Regel fünf: ein Privatschuh, zwei schwarze offizielle, zwei weiße offizielle. Warum gleich zwei weiße? Für die weiße Uniform (in warmen Regionen) – falls mal ein Schuh zerschlissen ist, muss ein Reservepaar bereit stehen, weiße Lederschuhe finden sich wahrlich nicht in jeder Hafenstadt. Ja, und dann gäbe es noch die kleinen Geschichten zu erzählen, die vom Doktor zum Beispiel, der neulich Abend strahlend und etwas verschämt in der Bar offenbarte, dass er jetzt auch Crocs trage. Croc steht für Crocodile, ein Ungetüm von offenem Schuh, gelocht und offenbar irrsinnig bequem, ganz Hollywood läuft neuerdings damit herum. Nur ist es so, dass die Crocs vom Doc Made in China sind und statt aus Kautschuk nur aus Plastik, sie haben in Skagen 6 Euro gekostet, ich habe die Kiste mit den bunten Dingern auch entdeckt. Er meinte aber, nachts sehe ja wohl niemand den Unterschied, wenn er mit seinem Ärzteköfferchen auf Patientenbesuch in eine Kabine huscht. Auch der Passagier mit dem verloren gegangenen Koffer ist fündig geworden, wir haben ja alle mit ihm mitgefühlt, eine so lange Reise und dann nicht genügend Kleidung, er hat in Waterford ein paar schwarze Slippers eingekauft, ziemlich entspannt, der Mann. Und natürlich der allerkleinste Schuh an Bord, dagegen sind die Stiefel der Japaner grobschlächtige Monster: zartrosa ist er, rund zehn Zentimeter lang und noch in Arbeit. Das Enkelkind kommt nächste Woche zur Welt (nicht an Bord!) und die Dame, die keinesfalls wie eine Oma aussieht, strickt schon fleißig.
Ob sich aufreizende, auffällige, hochhackige oder handgemachte Schuhe an Bord befinden, werde ich wohl erst beim Käptn’s Dinner sehen. Ich auf alle Fälle werde meine schwarzen Stiefel tragen.
12. Tag - Schönheit, Klugheit, langes Leben
Roscoff, Frankreich

Es lässt sich leider nicht verhindern, das Klischee muss bedient werden: Oh sinnliches Frankreich! Dein Essen, dein Charme, deine Düfte! Nicht zu vergessen, l’amour; ja, auch die Liebe hat heute einen guten Moment in Roscoff erfahren.
Ein Bilderbuchfrankreichtag ist das. Und aus mir ist schlagartig die Liebhaberin einer in silbriges Grau getauchten Kleinstadt am nordwestlichen Zipfel des europäischen Festlands geworden. Während ich mit Marie und ihrer Tante die letzen Tage in wackeligem Französisch herumgestammelt habe, fließen mir nun die Worte nur so über die Lippen. Ich betrete französischen Boden und – voilà, längst Vergessenes ist wieder da.
Der Vormittag allerdings fängt schweigsam an. Ein längerer Spaziergang, vorbei an Artischockenfeldern, über einen Klippenweg, traumhafte Aussichten, plötzlich ein süßer Duft, immer kräftiger werdend, changierend, ein neuer Geruch, wärmer, vertraut, sofort tauchen die Assoziationen im Kopf auf, es heißt, Gerüche würden sich Menschen stärker einprägen als Bilder oder Töne. Es riecht wie im südlichen Afrika, im Botanischen Garten Kirstenbosch in Kapstadt, ein herrlicher Duft. Der kleine Garten über den Klippen von Roscoff ist ganz der südlichen Hemisphäre gewidmet, nur die schwarzen Schildkröten, die an der Sonne an steilen Felsen zu kleben scheinen, stammen aus Florida. Ansonsten Pflanzenpracht aus Neuseeland, Chile, Australien und Südafrika. Ich bin die einzige Besucherin zu so früher Stunde, die roten Proteen blühen ganz für mich alleine.
Auf dem Rückweg ein Gespräch mit einem Mann mit Golden Retriver, wir tauschen uns über geriatrische Leiden von Hunden aus, ich empfehle getrockneten Weihrauch, er schwört auf die hiesigen Algen, die er unters Futter mischt. Auch dieser Fremde ein Seemann, es ist, als ob wirklich jeder Mann, auf den ich treffe, zur See gefahren sei. Dieser war bei der französischen Marine, 33 Jahre lang, mit 52 wurde er pensioniert. Er nahm am ersten Golfkrieg teil, kaum traumatisiert sei er, einzig nachts wache er manchmal auf, weil er von den Minen träumt, die das Schiff zu umfahren suchte.
In der Stadt ein Greis, der mich strahlend mit Bonjour Mademoiselle empfängt und umgarnt, was entweder seiner Sehstärke oder seinem Charme geschuldet ist. Ein paar Meter weiter ein anerkennend pfeifender Lieferwagenchauffeur, was ist bloß los, ist das hier immer so? Beschwingt (auch von den Komplimenten) sehe ich diese Stadt in bestem Licht. Blumenwände thronen vor grauem Stein, eine edle Schlichtheit, als ob ganz Roscoff als Monolith erdacht worden wäre. Aus der gotischen Notre-Dame-de-Croas-Batz erklingt Gesang, verblühte Hortensien in dunkelstem Rot stehen hinter der Kirchenmauer wie müde Wächter, die an den ewigen Kreislauf von Leben und Sterben gemahnen.
Am Eingang der Kirche eine dralle Braut mit hochgestecktem Haar in chamois-farbenem Taft, neben ihr der Brautführer, die Kirche ist gefüllt, die Gäste sitzen und schauen der jungen Frau ins Gesicht, sie hält den Blicken stand. Die Braut schreitet zu ihrem Bräutigam, Sonnenblumengestecke säumen ihren Weg, er steht da ganz in Weiß (mit braunen Schuhen, leider), sanfte Popmusik vom Band, Gesang voller Pathos, Katholizismus pur, ein Priester im langen Gewand, der Altarraum in üppigem Gold, eine einzige Schwelgerei.
Stéphanie und Philippe also. Vor dem Brautpaar tummeln sich ungeniert kichernd die Blumenmädchen, ein Kleinkind wackelt brabbelnd zum Altar hoch, kein Mensch stört sich daran. Die Braut greift zum Mikrofon, sie bedankt sich bei Verwandten und Freunden, der Priester bietet dem jungen Mann in Weiß das Mikro an, er will es nicht, der Geistliche meint, Philippe hat nichts zu sagen, Gelächter in der Kirche. Es wird viel gesungen hier, aber nicht etwa von Gott, sondern von der Liebe, sogar der Geistliche erteilt den Segen Gottes mit den Worten: dass ihre Liebe immer größer werde. Das schönste Lied heißt: L’amour comporte la liberté. Es tut ganz gut, das so zu hören. Hoffen darf man ja, dass die Freiheit erhalten bleibt, auch wenn ich es zu bezweifeln wage.
Das Ja-Wort verpasse ich, das Schiff wird nicht warten wegen einer nord-französischen Ehe, die gerade geschlossen wird. Ich wünsche Stéphanie und Philippe gedanklich nur das Beste und gehe zurück zur Bremen, ein wenig gerührt, als ich den schmucken Oldtimer sehe, der vor der Tür auf die beiden wartet. Beschwörung des großen Glücks.
Zurück auf Deck 5 schwinge ich die weißen Plastiktüten, in denen allerlei Gutes steckt. Vorgestern noch spottete ein Passagier: Dass Frauen sich immer gegenseitig zeigen müssen, was sie eingekauft haben! Womöglich hat er Recht. Wir stehen also da mit unseren Tüten und oh! und ah! was für Köstlichkeiten und Extravaganzen wir herauskramen. Bei mir sind es:
Caramel au Beurre Salé au Sel de Guérande (Süßkram)
Salicorne en marinade (Eingelegte Algen in Würmchenform)
Moutarde douce aux algues (Senf)
Fleur de Sel de Guérande (Edelsalz für die WG)
Ein Giftgrünes Gefäß mit kleinem Löffel für das Fleur de Sel
Soupe de poissons parfumé aux algues (Fischsuppe im Glas für Mama)
Savon doux (Lila Seife als Geschenk)
Masque Modelant Alginate (Gesichtsmaske für heute Abend)
Algo Plus Spiruline (Pillen für Schönheit, Klugheit, langes Leben)
So soll es sein: Schönheit, Klugheit, langes Leben. Das gilt für uns alle.
13. Tag - Ihre Majestät, die Queen
Isle of Wight, England

Langsam wird es unheimlich. Der Käpt’n unkt schon, Seefahrer seien womöglich mein Schicksal. Auf dieser Reise ist das wohl so. Der Fremde von heute hat die vorherigen noch übertroffen. Wann lernt man schon den Chairman eines polnischen Zerstörers kennen? Überhaupt war dieser Tag ganz und gar der Seefahrt gewidmet, mit einem geradezu majestätischen Abschluss.
Fangen wir ganz vorne an:
Mein Patenkind ist letzte Woche fünf geworden. Der kleine Laszlo ist ein Junge mit Geschmack und ich denke mir, ein weißer Triumph GT6 MK 3 dürfte ihm gefallen. In dem Alter glauben einem die Kinder ja noch alles und ich werde ihm erklären, dass die schönsten Autos der Welt schon immer die englischen waren. Drum stehe ich in einem winzigen Modellautogeschäft in Cowes und sehe mich um. Was es hier alles gibt und vor allem: wer sich hier so drängt und welch seltsame Fragen diese Leute stellen! Der Verkäufer ist sichtlich überfordert, wir kommen später ins Gespräch.
Tim Gladdis’ Familie lebt seit fünf Generationen auf der Isle of Whight. Großvater Thomas Gladdis war Schiffsbauer, der Vater auch. Während des Zweiten Weltkriegs lag auch die Blyskawica in Cowes in der Werft. Ein paar Jahre zuvor war das Kriegsschiff hier im Auftrag der polnischen Regierung gebaut worden, Großvater Gladdis hatte es Tag für Tag wachsen sehen. 1942 kümmerte er sich gerade um die Überholung des 390 Fuß langen Kahns, als der Angriff der Deutschen stattfand. Bomben fielen auf die Insel, die Blyskawica verteidigte Cowes und wurde so zu einer Art Local Hero.
Der junge Tim kennt diese Geschichten nur aus Erzählungen, geboren wurde er zwanzig Jahre später. Er fuhr erst zur See, wurde später Künstler, das Thema seiner naturalistischen Malerei: Cowes und die Schifffahrt. Zwischendurch hilft er einem Freund im Spielzeugautogeschäft aus, aber richtig versiert ist er darin nicht. Denn seine Leidenschaft gehört der Blyskawica (wie er liebevoll über sie sagt: she has a stands; ein Zerstörer mit Charakter gewissermaßen; etwas eigenwillig, dieses englische Faible für Kriegsgerät). Die Blyskawica liegt jetzt wieder in Polen und Tim Gladdis vertritt ihre Interessen in England, er ist ihr Chairman. Diesen Sommer hat er den polnischen Botschafter samt Militärattaché auf die Insel geholt, einen Riesenwirbel hat er verursacht in der kleinen Stadt.
Wobei Cowes sowieso einen etwas irren Eindruck macht, wie jeder Ort, der sich einer einzigen Leidenschaft verschrieben hat. Die Isle of Whight ist das Mekka der Segler, Cowes ihr ultimatives Ziel. Ich stehe vor dem berühmtesten Yachtclub Englands, versuche mich an dem Pförtnerhaus vorbei zu schleichen, keine Chance, die Herren lassen mich nicht hinein in das Clubhaus, das einer Festung gleicht. Seit 1858 residiert die Royal Yacht Squadron hier, die königliche Familie ist selbstverständlich Teil der elitären Gemeinschaft. Ein paar Lords hatten 1815 beschlossen, sich zweimal im Jahr zu treffen, um genüsslich mit einem Drink in der Hand ihren umgebauten Arbeitsschiffen bei Wettfahrten zuzuschauen, Lotsen und Fischer segelten für sie. Schon wenige Jahre später wurde den Adligen diese Art Wettrennen zu öde, sie begaben sich selbst an Bord. Der Grundstein für die Coves Weeks war gesetzt. Doch Adel bleibt Adel und die Türen des Clubs öffnen sich nicht für jeden. Man kann nicht einfach Mitglied werden, Geld hin oder her, man wird vorgeschlagen, und wer sich die Blöße gibt, um eine Mitgliedschaft anzufragen, hat schon den ersten Fehler gemacht. Das auf alle Fälle erzählen mir fünf ältere Herren, die in einem Ausguck aus weiß gestrichenem Metall thronen und traurig eine hängende Flagge beäugen.
Flaute und kein Wind in Sicht. Der Island Sailing Club liegt zweihundert Meter weiter östlich und hat ebenfalls die Königin als Patronin, doch wie einer der Herren nicht ohne Ironie gesteht: sie kam noch nie zu Besuch.
13 Segelboote warten auf den Start der Regatta, aber eben, nicht der leiseste Hauch von einem Wind. Die Herren trinken Tee, erzählen mir alte Geschichten und rufen unisono zum Abschied: cheerio! Einer begleitet mich auf die Terrasse, streckt einen Finger in die Luft und schüttelt resigniert den Kopf.
Am Nachmittag dann doch noch ein wenig Wind, aus allen Ecken kommen Yachten und kleine Segelboote angefahren. Ich stehe auf dem Sonnendeck und zähle: 247 Stück sind zu sehen, dazwischen ziehen Containerschiffe stur durch das Wasser, ein Trubel auf See, der seinesgleichen sucht.
Der krönende Abschluss ist dann die Begegnung mit der Queen Mary 2. Ehrlich, ich bin jetzt noch ganz gerührt. Sie schwimmt langsam auf uns zu, perfektes Abendlicht, ein Polizeiboot scheucht hektisch einen Segler vor ihr weg, wir stehen auf der Brückennock, Ferngläser vor den Augen, ein riesiger schwarzer Koloss schiebt sich vor uns, elegant ist sie ja, trotz ihrer Größe. Sollen wir es wagen sie zu grüßen? Ja, wir tun es, Paul lässt das Horn dreimal tuten, ein tiefer, guter Sound. Wir warten gespannt. Wird sie antworten? Nein, natürlich nicht, warum sollte sie. Sie wird arrogant und edel an uns vorbeiziehen auf ihrem Weg nach New York. Plötzlich dann ihr Horn, dreimal, ein gewaltiger Ton (mindestens ein Zweiklang, meinen die Musiker, die das Spektakel von Land aus beobacht haben) wie aus einer anderen Zeit, erzeugt mit Dampf. Ihr Typhon hat sie von ihrer Vorgängerin übernommen, es ist tatsächlich ein Ton aus der Vergangenheit. Her majesty the Queen hat uns zurück gegrüßt. Wir bedanken uns mit einem kurzen Signal, sie tut es auch. Mitten in diesem eh schon emotionalen Moment kommt die Dame, die nicht wie eine Oma aussieht, die Treppe hoch, und teilt ihrem Cousin und uns mit: Ich bin Oma geworden! 4,3 Kilo, ein strammes Mädchen. Wir freuen uns, über das neue Leben, über die QM2, über das Reisen auf einem Schiff, den Sonnenuntergang, über unsere dicke, kleine Bremen, einfach über alles. What a great day.
14. Tag - Der Zauberer und die Nonne
Portsmouth, England

Gestern habe ich Post erhalten. Meine Freundin Barbara schrieb mir, sie lese mein Tagebuch mit großem Vergnügen, vor allem an der Interpunktion scheint sie Gefallen gefunden zu haben (was mir natürlich zu denken gibt). Barbara ist eine promovierte Linguistin mit messerscharfem Verstand. Ihr Kommentar, meine Idiosynkrasien seien besonders herrlich, ließ mich zum Lexikon greifen.
Da stand, Idiosynkrasie lasse sich am besten mit dem Wort Eigentümlichkeit übersetzen. Es war aber noch mehr zu lesen. Idiosynkrasie ist auch:
- ein von der Gruppe abweichendes Verhalten
- starke Abneigung gegenüber bestimmten Personen, Reizen, Gegenständen
- Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Stoffen; teilweise Pseudoallergie
- aus dem Griechischen übersetzt bedeutet es so etwas wie: Selbst-Charakter
Mit diesem neuen Wissen will ich heute also Portsmouth betrachten und radle los. Schon der Security Officer (nicht der nette Österreicher von Bord, sondern ein bodygebildeter Engländer in fluoreszierender Weste, mit Glatze und beunruhigend männlicher Ausstrahlung) scheint meine Eigentümlichkeit zu ahnen, will mir seine eigene präsentieren und redet deshalb wild auf mich ein. Wie sich bald herausstellt, ist er nur im Nebenberuf für die Sicherheit des Hafens zuständig, sein eigentlicher Beruf: er ist Magier. Auf seiner Visitenkarte linst ein weißes Kaninchen aus einem Hut und er bietet sich als persönlicher Begleitschutz an. Ich lehne dankend ab und fahre durch das großräumige Hafengebiet Richtung Innenstadt, die Fregatten und Flugzeugträger (alte Pötte, wie der Kapitän meint) zu meiner Linken, martialisch, ein Land, das den Krieg gewohnt ist. Portsmouth ist nicht eben das, was man eine schöne Stadt nennen würde, zerstört, fragmentarisch wieder aufgebaut, die Wohngebiete rund um den Hafen ärmlich, Reihenhäuser säumen die Straßen, bei manchen gibt es Blumen im Vorgarten, manchmal flattert Wäsche im Wind, es ist ruhig, die Geschäfte sind verriegelt, nur das Tattoostudio hat geöffnet, ein angenehmer Sonntagmorgen.
Vor mir taucht die St John’s Catholic Cathedral auf, ach, warum nicht noch einmal in die Kirche gehen, wenn doch schon Sonntag ist. Und trauriger als bei den gottesfürchtigen Männern in Schottland kann es ja wohl nicht werden. Die Messe beginnt, jede Reihe ist belegt, dicht an dicht sitzen die Menschen, die Orgel erklingt, ein blau gewandeter Chor singt, alle stimmen mit ein, wir erheben uns, der Pfarrer schreitet durch den Mittelgang, die Messdiener schwingen Weihrauch, Kinder afrikanischen, indischen und asiatischen Ursprungs; es ist die weite Welt, die hier sitzt und singt, das Empire war groß und das Christentum weit gestreut. Und alle sind sie heute hier.
Auf einigen Jacketts und Sonntagkleidern kleben schmale Streifen aus Papier, Vornamen stehen darauf. Neben mir eine Frau namens Jordan. Sie singt die Lieder auswendig, mit klarer Stimme, ich höre mit und orientiere mich an ihrem Gesang. Ich betrachte das schlanke Kirchenschiff, schaue den Kindern zu, wie sie auf den Bänken zappeln, singe leise (weil falsch) und fühle mich ganz wohl. Am Ende greife ich nach meinem Fahrradhelm (Pflicht!) und will mich auf den Weg machen, da spricht mich Jordan an. Ob ich öfter hier sei? Sie lädt mich zu Kaffee und Kuchen in den Gemeinderaum ein, ich gehe einfach mit, die einzige ohne Schild am Hemd. Eine Peggy setzt sich zu uns, sie sieht aus wie Marianne Faithfull, ich sage es ihr, sie nimmt es als Kompliment, so ist es auch gemeint.
Jordan wohnt erst seit drei Wochen in Portsmouth, zuvor war sie für ein Jahr in Cambridge und noch davor 12 Jahre in einem Kloster nicht weit von hier. Jordan hieß einst Barbara, sie ist 42 Jahre alt, eine schmale, blonde Frau mit einem klaren Blick und einem starken Willen. Zweimal musste sie diesen Willen durchsetzen: als sie als junge Frau Nonne werden wollte und später noch einmal, als sie das Kloster wieder verlassen wollte, einfach war das nicht. Sie hat drei Jahre gebraucht, bis sie gemerkt hat, wie sehr ihr die Enge der Schwesterngemeinschaft die Luft abgeschnürt hat, wie sie immer unglücklicher wurde, wie sich ihr Gespräch mit Gott durch ihre Unzufriedenheit nicht verbessert hat, sondern ganz im Gegenteil wenig Zeit für dieses Gespräch blieb. Nur zu acht waren sie im Kloster, tagtäglich die selben Gesichter, die immergleichen Rituale, sie kam kaum hinaus in die Welt, dabei hätte sie gerne draußen gearbeitet, Menschen geholfen, sich mit ihnen ausgetauscht.
Wir trinken unseren Kaffee und ich bewundere den doppelten Mut dieser Frau. Manchmal, so sagt sie, sei ihr, als ob sie aus dem Nest gefallen sei, aber sie habe das erste Jahr genossen, Kino, Kneipen, Lachen, einfach so leben, wie wir das alle kennen. Jetzt arbeitet sie als Seelsorgerin an der Uni, betreut die Studenten, die in Not sind, Christen, Muslime, Hindus, Portsmouth ist eine internationale Stadt.
Als wir die Kirche verlassen, beginnt schon die Mittagsmesse. Wir stehen auf der Straße und verabschieden uns, zwei Frauen im selben Alter mit solch unterschiedlichen Biografien. Gestern hatte ich noch gehofft: morgen lernst du eine Frau kennen und bloß keinen weiteren Seemann mehr. Und schon ist sie da. Manchmal fallen sie einem zu, die Frauen, so wie Jordan zum Beispiel (die sich diesen Männernamen übrigens ausgesucht hat, als sie ins Kloster eingetreten ist. Jordan war ein Priester im 13. Jahrhundert, der wegen seiner Liebesbriefe berühmt geworden ist, Briefe an eine Frau).
Ich gebe mich einem weiteren Aspekt meiner Idiosynkrasie hin (tolles Wort, nicht wahr?): der starken Abneigung gegenüber bestimmten Personen, Reizen, Gegenständen. So radle ich also zum Museumshafen und schaue mir mit einer Menge anderer Touristen Kriegsschiffe der Royal Navy an. Die HMS Warrior 1860 ist beeindruckend, aber mein Widerstand gegen Militärisches doch zu groß. Lieber fahre ich noch ein wenig durch die ganz normalen Wohnviertel der Stadt.
Der leuchtende Magier steht übrigens an anderer Stelle im Hafen. Er meint, er habe auf mich gewartet. Eigentümliche ziehen Eigentümliche an. Aber der Typ ist mir dann doch zu schräg.
Mag sein, dass mit eigentümlich einfach nur schrullig gemeint ist. Mag sein, dass ich das bin. Aber damit lässt sich recht gut leben. Und Schrulligkeit soll mit den Jahren ja immer schlimmer werden…..
15. Tag - Gemischtes Allerlei
Auf See, Richtung Helgoland

Diverse kleine Dinge gibt es noch zu erzählen, es folgt eine lose Zusammenstellung, zu verstehen als assoziative Gedankenkette, ganz ohne Ranganspruch. Und weil ich Listen liebe, wird die eine oder andere mit dabei sein. Ein jeder hat seinen Fetisch, was dem einen seine Leuchttürme, sind der anderen ihre Listen.
Haariges
Mehrere Passagiere haben mich um den Markennamen vom Shampoo des Chiefs (Sinus) gebeten. Da ich gestern Abend mit ihm gegessen habe, war es ein Leichtes, das Thema noch einmal anzusprechen, Tischgespräche können durchaus munter sein. Heute also bringt er mir eine rote Tüte voll mit Kosmetika zur Ansicht. Für die Haare sind dabei:
- American Crew. Citrus mint. Friseurexklusiv (Shampoo)
- Sebastian. Xtah. Crude clay, Friseurexklusiv (Styling Wachs und Styling Creme)
Viel entscheidender aber, meint Sinus, sei das folgende Produkt:
- Aveda. Foot relief (Fußcreme)
Regelmäßig angewendet, verschwinde die Hornhaut wie von selbst und die Füße seien so zart wie die eines Babys.
Lynn
Baby Lynn erlebt heute ihren dritten Erdentag im fernen Paderborn, es gehe ihr prächtig und neue (diesmal weiße) Schühchen sind bereits in Arbeit.
Heiße Eisen
Von den heißesten Schuhen an Bord wurde mir ebenfalls von Passagieren berichtet, ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Es sind:
- ein Paar hochhackige rote Tango-Argentino-Schuhe (Passagierin)
- ein Paar eng anliegende, hohe schwarze Lederstiefel mit einem gewagten Bleistiftabsatz aus glänzendem Metall (weibliches Crewmitglied auf Landgang)
Kaufrausch
Wo kaufen Seeleute ein?
- Schuhe am liebsten in Spanien und Italien, bester Hafen ist Cadiz
- CDs in Russland und China, für ein paar Dollar und nicht ganz legal
- Maßanzüge in Asien, am besten in Vietnam. Heute bestellt, morgen geliefert. Overnight stops sind daher besonders beliebt
- Elektronisches in Singapur
Funkstille
Ich habe (wie die meisten) mein Handy mitgenommen und freue mich über SMS-Mitteilungen von zuhause. Nur ist mir aufgefallen, dass der Akku andauernd leer ist, kaum will ich eine SMS schreiben, ist alles tot. Erst dachte ich, es liegt am Aufbewahrungsort (überm Kühlschrank), zu heiß vielleicht. Dann überlegte ich mir, ob es wohl auch der Seegang sei (man erinnere sich an Doktors Theorie von den elektromagnetischen Schwingungen durch Ebbe und Flut, die unseren Schlaf durcheinander bringen; vielleicht wird das Handy dadurch auch ganz verrückt). Bis man mir erklärte, es liege a) daran, dass die Handys wegen der 60 Hertz-Frequenz nie ganz aufgeladen würden, und b) mein kleines Handy ununterbrochen die beste Empfangsstation sucht, von frühmorgens bis spätnachts und dann vor Erschöpfung einfach zusammenbricht.
Unwissenheit
Wenn wir vor Anker liegen (auf Reede, am Haken), hält uns nicht etwa der Anker selber an Ort und Stelle, vielmehr ist es das Gewicht der Kette. So banal das klingt, mir war es nicht bewusst. Nun frage ich mich, wozu die Anker dann diese Armstücke (oder Pfluge) haben. Ich bin mir sicher, morgen wird es mir jemand erklären können.
Die ekelhafteste Geschichte (bitte nur lesen, wer einen guten Magen hat)
Sie ist nicht hier an Bord passiert (sondern auf einem amerikanischen Schiff), aber die Story ist zu scheußlich, als dass ich sie vorenthalten könnte. Lektoren (früher sagte man dazu Vortragsreisende) gibt es ja auf verschiedenen Schiffen, die meisten sind hartgesottene Seefahrer, denen kein Seegang zu heftig ist. Traditionell ist samstags Eintopftag, weltweit gibt es diese Gepflogenheit. Es war also ein Samstag, man schlingerte durch einen schlimmen Sturm, nur wenige Passagiere waren überhaupt noch im Speisesaal. Unser Lektor saß am Tisch mit einem anderen Lektor, einem Kanadier, der angesichts der Schwierigkeit, die grüne Pampe im Teller essen zu können, flugs zu einer jener Tüten griff, die bei Windstärke 8 allzeit bereit herumliegen, zum freundlich genannten Spuckbeutel (Sickness bag, Sacchetto vomito, Sac vomitoire). Ihm war nicht etwa übel, nein, der Kanadier leerte den Eintopf in den Beutel um, löffelte ihn dann ungeniert und mit Genuss. Dies Bild gab auch dem letzten standfesten Passagier noch den Rest.
Und dann noch die netteste Geschichte
Unser Kapitän ist auch ein Leuchtturmfreak. Das ging bei ihm schon zeitig los, eine frühkindliche Erfahrung gewissermaßen. Als kleiner Junge durfte er mit seinem Vater immer Schiffe gucken gehen, auf der Westmole in Warnemünde. Dort steht ein Leuchtturm und Kind Daniel musste seine zarte Knabenhand drauf legen, das brachte ihm Glück. Während der Studienzeit hat sich dieser Tic nicht etwa verwachsen, sondern ist im Gegenteil noch stärker geworden. Seine Mitstudenten hatten sich schon Gedanken um seinen geistigen Zustand gemacht, doch Felgner war nicht abzuhalten: Angst ? Talisman aufsuchen ? Leuchtturm anfassen ? Glück. So ist das mit den Leidenschaften.
16. Tag - Heilende Hände und flinke Finger
Helgoland

Offensichtlich hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Nun sind es nicht mehr die Seeleute, sondern die Magier. Gestern Abend habe ich im Club gesessen, die Farewell-Party lag hinter uns, wir hatten kräftig gesungen, die Preise versteigert und gut gegessen, da sprach mich ein Passagier an und meinte, er könne auch zaubern. Ein wenig ungläubig setzen wir uns zu dritt um ihn herum, er zückte ein Skatspiel und vollführte die dollsten Tricks. Da waren Karten plötzlich verschwunden und tauchten an anderer Stelle wieder auf, er erriet, was wir in den Händen hatten und so weiter; das war alles recht beeindruckend.
Heute dann der nächste Magier. Er heißt Hans Stühmer und wohnt auf Helgoland. Ich wollte immer schon mal nach Helgoland und so grenzt es für mich bereits an Zauberei, dass wir überhaupt hier sind – wo wir doch eigentlich nach Borkum hätten fahren sollen. War aber nix, Wetter zu schlecht, also Helgoland. Geht alles recht flexibel zu und her hier (und wir haben allerlei erlebt: der größte Seenotrettungskreuzer Deutschlands demonstriert seine Leistungsfähigkeit, nur für uns, inklusive Dusche durch Löschfontänen).
Hans Stühmer ist 38 Jahre lang der Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamts des Außenbezirks Helgoland gewesen. 1967 kam er als junger Mensch hierher, wollte nur zwei Jahre bleiben, es wurde ein ganzes Leben daraus. Seine Frau und den Sohn hat er mitgebracht vom Festland auf die Insel, ein zweiter Sohn wurde hier geboren, ein echter Helgoländer sei das, sagt Stühmer, auch wenn die Alteingesessenen das ganz anders sehen (mindestens drei Generationen muss man nachweisen können, um akzeptiert zu werden). Aber alle sind mittlerweile weg, die Söhne und auch die Frau. Nur Hans Stühmer ist geblieben.
Manchmal arbeitet er im Laden von Frau Ludwig, direkt am Hafen in einem der kleinen bunten Holzhäuschen. Sein Leben dreht sich um den Roten Feuerstein, ein Stein, der sich nur auf der Düne findet, der flachen Nachbarin der Hauptinsel. Der Rote Feuerstein hat magische Kräfte und heilt allerlei Krankheiten. Wir sind zu viert in dem Geschäft und das Gespräch dreht sich um Magie und Energieflüsse. Eine Frau weiß zu berichten, dass die Heiler selber immer schwach und schwächer werden, weil die Kranken ihnen zu viel Kraft entziehen. Stühmer kann das nur bestätigen, er selber ist Reiki-Meister und hat heilende Hände; allerdings gab es auf der Insel einst einen alten Mann, der das noch viel besser konnte. Der Feuerstein wird hier seit je auf die Haut gelegt und seine Kräfte durchströmen den Körper. Vor allem bei Schuppenflechte seien gute Ergebnisse erzielt worden, auch Blasenleiden sollen verschwinden. Hans Stühmer sammelt den Stein schon so lange, wie er auf der Insel lebt. Er schleift mit einer Diamantsäge Platten daraus, die werden zu einem Silberschmied nach Oldenburg geschickt und eingefasst, als Ringe oder Armbänder kommen sie zurück. Polierte Steine werden als Kräfte spendende Handschmeichler verkauft. Ich suche mir präventiv gleich zwei Stück aus, kann ja vielleicht mal was nützen. Weil der Herr Stühmer so nett ist und die Atmosphäre eh schon kuschelig, kaufe ich eine rote Wärmeflasche mit Schweizer Kreuz darauf, angefertigt aus solidem Schweizer Armeefilz. Die Berliner Winter sind bekanntlich kalt.
Helgoland ist ein eigenwilliger Ort, ein roter Fels (Buntsandstein) mitten im Meer. Wahrscheinlich ist es im Sommer rappelvoll, womöglich gibt es deswegen diese eigentümlichen Parkbänke im Single-Format, falls der Mensch seinem Bedürfnis nach Alleinsein nachkommen will oder eine Phobie entwickelt hat (Idiosynkrasie).
Man lebt von der Kaufwut anderer Leute. Kleines Geschäft reiht sich an kleines Geschäft. Alles ist zollfrei und entsprechend begehrt. Ich lasse mich auch verführen und erstehe eine Flasche meines Parfums (Omnia von Bulgari). Als ich aus der Tür trete, schaue ich auf ein Kneipenschild, Bunte Kuh. Sieht gemütlich aus, könnte durchaus sein, dass unsere vier Bandmitglieder drin beim Bier sitzen. Ich entwickle langsam ein Gespür für ihre Vorlieben, vorgestern in Cowes sah ich ein Pub namens Old Inn, das ganz nach ihrem Geschmack hätte sein können – und tatsächlich, da waren sie, Männer mit einem Glas Guinness in der Hand. Heute allerdings habe ich mich getäuscht, keine Musiker weit und breit. Scheint noch eine nettere Kneipe auf Helgoland zu geben.
Ich könnte die gesamte Reise anhand der Cobblestones erzählen. Erstaunlich, wie schnell einem Fremde vertraut werden können (das lässt sich auch unter den Passagieren beobachten. Aus der Frau aus Wolfenbüttel wird irgendwann Frau Meyer und schließlich die Susie). Am ersten Abend dachte ich noch, ach, vier Mechaniker an Bord. Am nächsten Tag waren sie schon etwas aufgestylt, mit Jackett und so. Ab dem dritten Tag sahen sie immer chicer aus, coole Anzüge, manchmal sogar Krawatten. Irgendwie hat sich auch der Bartwuchs im Laufe der Wochen verändert, will mir scheinen, jetzt tragen alle die gleiche Gesichtsfrisur.
Bald kannte ich ihre Namen, Martin, Andreas, Andreas, Marcus, ein paar Tage später die Spitznamen: Hotte, Macherauch, Bernhardt, nur Martin ist Martin geblieben. Sie kommen aus Berlin-Reinickendorf. Und sie spielen Irish Music, elf Instrumente wechseln die flinken Hände (am tollsten: die Mundharmonika!). Den ersten Auftritt hatte ich verpasst. Aber ich habe sie üben gehört, nachmittags im Club, keine Passagiere waren da, ganz leise haben sie gespielt. Ihre Lieder sind mir vertraut geworden, meist handeln sie von Frauen, Schiffen und vom Suff. Scheint in Irland so zu sein. Mein Lieblingsstück geht um einen Toten, dessen Freunde ihn begraben sollen, es des Bieres wegen aber vergessen.
Als ich die vier Jungs dann das erste Mal auf der Bühne sah, war ich doch bass erstaunt. Nicht weil es gut klang (das hatte ich nicht anders erwartet), vielmehr weil mir ihre Gestik und Mimik so bekannt vorkam, sie auf der Bühne aber noch gesteigert wurde, herausgearbeitet irgendwie, glasklar. Macherauch, der Mensch mit dem schnellen Wortwitz, mit zuckenden Schultern und springenden Augenbrauen; Bernhardt, ein gelassener Mann mit mildem Lächeln, an dessen sicherer Seite sie alle ruhen; Hotte, der flotte, neckische Junge zwischen den drei urchigen Kerlen; schließlich Martin, der vom Typ her auch in einer Hardrock-Band spielen könnte, ein Organisator, der aufblüht und leuchtet auf der Bühne.
Sie haben dann noch einmal gespielt, unten auf dem Lower Deck, für die Crew. Eine Atmosphäre wie in einem Partykeller, damals, als wir 15 waren, Bier nur aus der Flasche tranken und alles leuchtete und flackerte, das ganze Leben. So war es auch vorgestern, einer jener glücklichen Momente, nicht nur für mich. Es war eng, heiß und stickig, das Schiff schwankte, die Jungs spielten frisch und der Sound war super. In dieser Nacht habe ich mitgesungen, Lieder über My Mom, irgendeine Dirty Old Town und natürlich über den toten Paddy Murphy. Und – Sinus wird es kaum glauben – ich habe ein Bier getrunken, oder zumindest fast.
Anmerkung: The Cobblestones. Live in Berlin am 5. Oktober ab 19 Uhr, Heilig-Kreuz-Kirche, Zossener Straße 65, Berlin Kreuzberg. www.cobblestones.de
17. Tag - Illusionen sind das Schönste auf der Welt
(Hildegard Knef)
Esbjerg

Heute der Tag in aller Kürze: Ein letztes Mal einen Blick auf die dänische Provinz geworfen, ein tolles Museum besucht (historische Einrichtungen um 1900; steif, eng, düster). Habe mich allerdings über den Geschmack der Dänen gewundert, beim Eintreten ins Museum als Erstes zu sehen: eine schwarze Wand mit 16 schwarzen Totenköpfen darauf, daneben der Schriftzug Zeit – Mensch – Museum. War eine Schenkung eines Künstlers, die Leitung wusste nicht wohin damit und hat die Installation halt in den Eingang gestellt. Anschließend ein schreckliches Museum eilig durchschritten (moderne dänische Kunst, traurige Nachahmer von Klee, noch traurigere von Kandinsky), danach wollte ich nur noch zurück aufs Schiff. Dort gleich von einem meiner Lieblingspassagiere herbei gewinkt worden mit den Worten: da kommt unsere Frömmin (was für einen Ruf ich habe!). Ist mir aber lieber als: unsere Frau Zora ist nicht seefest (was mich ein wenig kränkt, schließlich habe ich den Doktor beim Nordsee-Crossing nicht benötigt und das Ganze ohne Pillen durchgestanden). Der Mann zeigt mir einen Prospekt der Saedden Kirke, 1977 entworfen, und ich denke zum ersten Mal: Mist, da habe ich was verpasst. Ein großartiger Innenraum, ein Lichtermeer in moderner Backsteinarchitektur. Mein Architektinnenherz geht mit mir durch, kurz die Überlegung, mich ins Taxi zu setzen und noch hinzufahren. Habe aber keine Zeit, denn es fehlt noch die dritte und letzte Blitzumfrage:
Was bedeutet die Bremen für Sie ganz persönlich?
- Kontrolliertes Abenteuer (Crew)
- Meine Familie, ich habe keine mehr (Crew)
- Ein Stück Nostalgie (Passagier)
- Sie ist das schönste und liebste Schiff überhaupt (Passagierin)
- Intimität (Passagier)
- Fragen Sie mich lieber nach der alten Bremen (Passagierin)
- Sie ist noch ein richtiges Schiff (Passagier)
- Ist mein Arbeitsplatz (Crew)
- Sie funktioniert wie eine Familie: es gibt Nahestehende, Angeheiratete, entfernte Verwandte und solche, die man nicht kennen möchte (Passagierin)
- Einfach nur ein komfortables Transportmittel (Passagierin)
- Es war Liebe auf den ersten Blick (zweimal Crew)
- Sie führt an Orte, an die man ohne sie nicht käme (Crew)
- Es ist jedes Mal wieder wie nach Hause kommen (mehrere Passagiere)
- Wärme. Es ist gut, dass sie nur 4 Sterne hat. Mehr Sterne bedeuten mehr Kälte (Passagierin)
- Sie ist das tollste Schiff auf der Welt. So wie meine Frau zuhause auf den Philippinen die schönste Frau der Welt ist. Ich bin loyal (Crew)
- In familiärer Atmosphäre an ungewöhnliche Orte fahren (mehrere Passagiere)
- Freiheit, finanzielle Absicherung, viele lieb gewonnene Freunde (Crew)
- Ich bin von der Antarktis infiziert. Mit der Bremen kann ich da hin (Crew)
- Ein schwimmendes Wohnzimmer (Crew)
Und was bedeutet die Bremen mir persönlich?
Es gibt diese einzelnen Momente, die mir unvergesslich bleiben. Oft haben sie nichts mit Landgängen zu tun, sondern vielmehr mit der Seefahrt selber, es sind gewisse Stimmungen an Bord, die ich liebe, meist finden sie im Dunkeln statt.
Zum Beispiel neulich nachts im Ärmelkanal, als die Möwen uns begleiteten, Dutzende, ganz nah über und hinter uns, von unserer Hecklampe hell erleuchtet, schneeweiße Bäuche erstrahlten da, majestätische Tiere, mit rhythmischem Flügelschlag in der Luft tanzend, auf und ab, wunderschön.
Oder gestern Nacht die Minuten auf der Brücke. Schon der Brückengang auf Deck 6 gefällt mir, das schummrig rote Licht, das diese paar Meter beleuchtet, die Wände voll mit Hafenplaketten; leises Öffnen der Brückentür, es ist dunkel, einen Moment die Augen ans Dunkel gewöhnen, schauen, wer da noch steht, erst sind es Schemen, daraus werden vertraute Menschen. Sonst nur kleine bunte Lichter, das tickende Geräusch des Barografen, der Radarschirm das Hellste im Raum. Dann die Stimme des Lotsen, steer one zero five, der Rudergänger wiederholt, yes Sir, one zero five, regelt den Kurs ein, dann one zero five now. Schweigen. Der Wind pfeift, Helgoland wird langsam kleiner, ein grauer Fels in grauem Meer, umwoben von Wolken, der Mond scheint durch und einzelne Stellen werden in Silber getaucht.
Dann die kurze Szene auf dem Panoramadeck, ebenfalls nachts. Eine Passagierin steht neben dem Vorhang, ganz allein, sie geht nie essen abends, weil sie diese Zeit für sich haben möchte. Wir schwatzen noch beim Eintreten, sehen die Frau und ziehen uns leise zurück, wollen sie nicht stören, wie sie da steht und aufs Wasser blickt.
Meine allerliebste Zeit aber ist diese eine Stunde, abends zwischen halb acht und halb neun. Ich bin versucht, sie die Blaue Stunde zu nennen, obwohl sie das nicht unbedingt sein muss. Sie findet auch nicht überall statt, sondern nur an einem Ort auf dem Schiff, auf einer Fläche von nicht mehr als 20 Quadratmetern, im Club nämlich, um den Tresen herum, backbord. Es ist ganz ruhig, die Passagiere sind im Speisesaal, nach und nach trudeln zwei, drei Offiziere ein, jemand vom Staff, der Küchenchef schaut kurz vorbei, vielleicht die Musiker, vielleicht ein Lektor, mal sind es mehr, mal weniger, es besteht kein Zwang, niemand muss teilnehmen, hier findet kein Arbeitsmeeting statt, es ist einfach ein Moment des Austauschs oder aber auch des Miteinander-Schweigens, Zeit, etwas gemeinsam zu trinken, durchzuatmen. Das Licht ist schon gedimmt, die Musik spielt, manchmal leise, manchmal lauter, gestern haben wir südamerikanische Klänge gehört, jemand hat auf seinem Rechner Bilder vom Amazonas gezeigt. Ein anderes Mal saßen wir da und haben uns über Gartenprobleme unterhalten (welche Pflanzen vertragen die lange Abwesenheit, wer mäht eigentlich den Rasen; ich weiß jetzt, dass Eukalyptus-Bäume einen enormen Wasserverbrauch haben und für trockene Regionen tödlich sind), es sind Gespräche, wie es sie überall gibt, Belangloses, Kritisches, Lustiges, einfach ganz normales Reden. Der Club um acht ist das ruhig schlagende Herz der MS Bremen, ein pulsierendes, strömendes Gefühl von Gemeinsamkeit steigt auf. Ich gebe mich der Illusion hin, ein wenig dazuzugehören, ein temporärer Teil zu sein dieses sich immer verändernden Kreises.